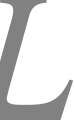aus der Serie Schwimmübungen, 120-teilig, 2006, Öl auf Leinwand, 20 x 20 / 30 x 30 / 20 x 50 / 30 x 40 cm, Raumansicht. Foto: Vera Kattler
aus der Serie Schwimmübungen, 120-teilig, 2006, Öl auf Leinwand, 20 x 20 / 30 x 30 / 20 x 50 / 30 x 40 cm, Raumansicht. Foto: Vera Kattler
 aus der Serie Mausmanie, 313-teilig, 2011, Öl auf Papier, je 30 x 40 cm, Ausstellungsansicht Museum St. Wendel, 2013. Foto: Vera Kattler
aus der Serie Mausmanie, 313-teilig, 2011, Öl auf Papier, je 30 x 40 cm, Ausstellungsansicht Museum St. Wendel, 2013. Foto: Vera Kattler
 Krähenformung, 2013, Scherenschnitt, Mobile, Ausstellungsansicht Museum Schloss Fellenberg, Merzig, 2015. Foto: Vera Kattler
Krähenformung, 2013, Scherenschnitt, Mobile, Ausstellungsansicht Museum Schloss Fellenberg, Merzig, 2015. Foto: Vera Kattler
 Krähenformung, 2013, Scherenschnitt, Wandinstallation, Ausstellungsansicht Kunsthaus Norden, 2018. Foto: Vera Kattler
Krähenformung, 2013, Scherenschnitt, Wandinstallation, Ausstellungsansicht Kunsthaus Norden, 2018. Foto: Vera Kattler
 aus der Serie In den Wolken seh' ich immer Hunde, 50-teilig, 2014, Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm. Foto: Vera Kattler
aus der Serie In den Wolken seh' ich immer Hunde, 50-teilig, 2014, Öl auf Leinwand, 40 x 50 cm. Foto: Vera Kattler
 aus der Serie Vom Sammeln des Flügelschlags, 1000-teilig, 2017, Tusche auf Papier, je 14,8 x 21 cm. Foto: Vera Kattler
aus der Serie Vom Sammeln des Flügelschlags, 1000-teilig, 2017, Tusche auf Papier, je 14,8 x 21 cm. Foto: Vera Kattler
 aus der Serie Unklare Verwandtschaften, 200-teilig, 2017, Tusche auf Papier, je 29 x 21 cm. Foto: Vera Kattler
aus der Serie Unklare Verwandtschaften, 200-teilig, 2017, Tusche auf Papier, je 29 x 21 cm. Foto: Vera Kattler
 aus der Serie Masken, 30-teilig, 2018/19, Tetrapackdruck auf Seidenpapier, 39 x 25 / 34,5 x 25 / 39,5 x 27,5 / 34,5 x 25 cm. Ausstellungsansicht Schauraum am Laboratorium, 2022. Foto: Nina Jäger
aus der Serie Masken, 30-teilig, 2018/19, Tetrapackdruck auf Seidenpapier, 39 x 25 / 34,5 x 25 / 39,5 x 27,5 / 34,5 x 25 cm. Ausstellungsansicht Schauraum am Laboratorium, 2022. Foto: Nina Jäger
 aus der Serie Nachts unterm Futterplatz mit Totenblumen, 70-teilig, 2022, Kohle auf Papier, 21 x 30 cm. Foto: Vera Kattler
aus der Serie Nachts unterm Futterplatz mit Totenblumen, 70-teilig, 2022, Kohle auf Papier, 21 x 30 cm. Foto: Vera Kattler
Kattler, Vera
geboren 1965 in Wadgassen/Saar
lebt und arbeitet in Köllerbach und Saarbrücken
Kategorien: Malerei, Zeichnung, Neue Medien
Künstlerin und Werk
Von Anfang an beschäftigt sich Vera Kattler in ihrem künstlerischen Schaffen mit dem Tier. Dabei geht es ihr nicht um eine detailgetreue, wiedererkennbare Abbildung eines individuellen Vertreters der jeweiligen Spezies, sondern um das Animalische schlechthin, um das, was das Wesen Tier für uns ausmacht und welche Gefühle es bei uns auslöst.
Bereits in ihrer Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 widmet sie sich diesem Thema in unterschiedlichen Medien: in Gemälden von Kühen, Lamas und Schafen, in Kohlezeichnungen von Schimpansen und in einer Videoinstallation, in der sie das Verhalten eines Tapirs in den Blick nimmt. Um Besonderheiten des jeweiligen Tieres hervorzuheben, nutzt sie unkonventionelle Ansichten. In ihrer Malerei entwickelt sie das Motiv aus der Farbe, die sie bereits zu dieser Zeit zum Teil mit den Fingern aufträgt, um einen unmittelbaren Bezug zu ihrem Gegenüber aufzubauen. Das Tierbild wird mit dem Farbmaterial modelliert und erhält dadurch plastische Qualitäten. Kattler erreicht auf diese Weise eine sehr malerische und zugleich haptische Schilderung des Organischen.
Der Blickwinkel auf das Tier sowie die Wahl des Bildausschnitts sind ungewohnt und originell. Die Künstlerin rückt ihrem Modell oft sehr dicht auf den Leib, fängt von ganz nah, gegebenenfalls gar aus der Untersicht, momentane Haltungen und Eindrücke mit der Kamera ein. Die Fotos dienen ihr später als Ausgangspunkt für ihre freien malerischen Interpretationen. Ihre Gemälde zeigen farbgetränkte Individuen, die mit wenigen Details aus dem Kontext des indifferenten Umraumes herauswachsen. So kennen wir Tiere bislang nicht. Sie sind selbstverständlicher Teil des Ganzen und doch sehr außergewöhnlich.
Die malerisch verwischten Kohlezeichnungen legen in skizzenhafter Form Details von Schimpansen offen, die dicht nebeneinander präsentiert ein rhythmisch bewegtes Gesamtbild dieses Tieres visualisieren. Vera Kattler lotet zeichnerisch Charakterzüge einzelner Individuen wie auch typische Merkmale der gesamten Affenart in ihrer Vielfalt aus. Schon hier erarbeitet sie ihr Thema seriell, eine Methode, die sie im Anschluss als künstlerische Herangehensweise beibehalten wird.
Zunächst bleiben Säugetiere das wichtigste Sujet in ihren Werken. Das warme, wollige Fell beispielsweise interessiert die Malerin. Es muss nicht in der realen Färbung wiedergegeben sein, scheint jedoch Reflexionen der Umgebung widerzuspiegeln. Die koloristische Modifizierung bindet das Tier in sein Umfeld ein und verfremdet so das uns vermeintlich Wohlbekannte. Ein merkwürdiges Wesen schaut uns entgegen – herausfordernd, bedrohlich oder ängstlich. Über den Blickkontakt fordert es uns zur Kommunikation auf. Kattlers Tierbilder sind Porträts, die spezifische Eigenschaften festhalten, eine gewisse Zaghaftigkeit etwa, selbstbewusstes Dasein, physische Stärke oder Angriffslust. Mit klischeehaften Vorstellungen oder sentimentalen Verharmlosungen haben sie nichts zu tun. Immer gibt es eine weitere, unheilschwangere, schwer einzuschätzende Seite der Lebewesen.
Seltsam vertraut – dieser doppeldeutige Ausstellungstitel aus dem Jahr 2008 benennt die Polarität, die alle ihre Tierporträts ausstrahlen: Das andere Wesen, zu dem wir uns auf unbegreifliche Weise hingezogen fühlen und das wir zu kennen meinen, bleibt uns in gewissen Zügen immer fremd. Das liegt genauso am Anderen wie an uns selbst. Das seltsam Vertraute erfüllt uns mit Unbehagen. Nicht alles lässt sich erklären und rationell einordnen, darunter unsere eigenen Emotionen. Viele Titel ihrer Einzelausstellungen umkreisen den Aspekt des Undurchsichtigen und Mehrdeutigen: das kleine Monströse, nahezu menschlich, Krähenformung, mögliche Merkwürdigkeiten – alles Umschreibungen verstörender Metamorphosen.
Die Reptilienaugen aus dem Jahr 2008 irritieren durch explizit ausgewählte Details. Bunt schillernde, schuppige Haut, farbige Augäpfel und dunkel starrende Pupillen kristallisieren sich als identifizierbare Motive aus dem Sinnestaumel reiner Farbgestaltung. Bei aller ästhetischen Verlockung muss man als Betrachter*in den glubschenden Blick allerdings aushalten können. Auch die 120-teilige, 2006 entstandene Folge der Schwimmübungen unterliegt, koloristisch zurückgenommen, denselben Prinzipien. Wie die Wandinstallation methodisch Lücken mit einkalkuliert und die Einzelbilder beinahe zufällig zutage treten lässt, tauchen innerhalb der Tafeln Köpfe von Flusspferden nur fragmentarisch an der Oberfläche des graublauen Wassers empor. Es fällt schwer, die Motive exakt zu bestimmen. Manche Kreaturen ähneln Fischen, andere eher Säugetieren mit spitzen Schnauzen. Alle sind mit Augen versehen, die uns entschieden anstarren.
Eine maßgebliche Rolle in Kattlers Œuvre spielen Darstellungen von Menschenaffen. Sie kehren als Motiv immer wieder. Ab 2011 verschmelzen die markanten, sehr eindringlichen Physiognomien mehr und mehr mit dem Hintergrund. Einer Imagination gleich keimen sie aus flackernden, von Dunkelheit durchwobenen Farbschleiern auf und verursachen trotz der unbestreitbaren Faszination, die sie auf uns ausüben, ein tief beunruhigendes Gefühl. Der Bildausschnitt konzentriert sich auf das Gesicht der Affen, deren Augen uns beschwörend fixieren. Die geringe Distanz bedingt eine ungewöhnlich starke Präsenz dieser Hominiden. Ihrer hypnotischen Macht lässt sich kaum entrinnen.
nahezu menschlich wirken diese Porträts: Unsere Gemeinsamkeiten liegen ebenso auf der Hand wie die beklemmende Gewissheit der Andersartigkeit. Ein ähnliches Befremden schleicht sich in den wenigen Bildnissen von Menschen ein, an die sich die Künstlerin bis 2013 heranwagt, und intensiviert sich in den späteren Werkgruppen, die menschliche Figuren zum zentralen gestalterischen Forschungsgegenstand erheben: Köpfe, Unklare Verwandtschaften und Masken.
Neben den Gemälden nähert sie sich auch in Kohlezeichnungen mehrfach den Primaten, 2009 in einer Serie von 147 Gorillas in sehr nah herangezoomten, oft skurril oder unheimlich anmutenden Detailansichten mit hohem Abstraktionsgrad oder 2011/12 in formatfüllenden, realistischen und von Dunkelheit dominierten Porträtdarstellungen derselben Gattung.
2010 entdeckt Vera Kattler eine andere, weitaus unscheinbarere, jedoch die artenreichste Ordnung der Säugetiere als Sujet künstlerischer Auseinandersetzung: die Nagetiere, die sie kontinuierlich zu einer wahren Horde erweitert. In Öl auf Papier gemalt, schließt sie Hamster, Ratten, Mäuse und – bewusst ambivalent – sogenannte Wandelwesen ein, die keiner bestimmten Familie zugerechnet werden können. Anders als in den Leinwandbildern sind die Motive in den Papierarbeiten nicht eingebunden in ein übergreifendes Umfeld, sondern sitzen isoliert in der Mitte des leeren Blattes. Farbflecken und Fingerabdrücke bezeugen die Spontaneität des Entstehungsprozesses. Kattler malt immer noch, zumindest teilweise, mit den Fingern oder mit dem Pinselstiel. In raschem Wechsel entwickelt sie mehrere Variationen desselben Tieres als eigenständige Sequenz. Die Bilder umreißen verschiedene Aspekte des Animalischen, entfernen sich dabei zunehmend vom Modell, werden freier und vieldeutiger.
Weit weg von einer verniedlichenden Charakterisierung der kleinen, flinken Tierchen legt sie den Schwerpunkt auf das Unberechenbare und Gefährliche, auf das kleine Monströse. Während des schnellen Malvorgangs kommt es häufig vor, dass ihr der Pinsel ausrutscht und Spuren aufs Blatt setzt, die ursprünglich nicht beabsichtigt waren. Kattler akzeptiert diese Entgleisungen, nimmt die sich ergebenden Deformationen als abseitige Phänomene in Kauf. Deren Rätselhaftigkeit zieht uns in Bann und schreckt uns genauso sehr ab. 2011 potenziert die Malerin in der 313 Einzelblätter umfassenden Raumarbeit Mausmanie das Unbehagen über die Vielzahl orangefarbener Mäuse, die uns wie ein aufgereihtes Heer offensiv gegenüberstehen. Am Beispiel der Werkfolge Vom Sammeln des Flügelschlags bringt Veronika Olma überzeugend zur Sprache, dass selbst friedliche, gar zarte Individuen in massenhafter Wiederholung die Frage nach Machtstrukturen größerer Organisationen implizieren. Neben biologischen thematisiert die Künstlerin vor allem psychologische, philosophische und soziologische Aspekte.
Beklommenheit verursachen in den Darstellungen von Nagetieren auch Verwachsungen und Klumpenbildungen, wie sie z. B. in den zu einem unentwirrbaren Knäuel verflochtenen Rattenkönigen vorliegen. Die organischen Wucherungen lassen uns vor den Grausamkeiten der Natur erschauern. Vera Kattler macht es uns nicht leicht, weder in ihren surrealen Anomalien aus dem Tierreich noch in den sich zu einem düsteren Gestrüpp verdichtenden Pflanzen in den Kohlezeichnungen von 2010/11 oder dem ab 2013 entstandenen, bizarr verfilzten Wegesgekriech.
Im Jahr 2012 beginnt sie eine Werkgruppe, an der sie in unterschiedlichen Techniken arbeitet, die Krähenformung. Ob als Installation aus Scherenschnitten, als Linoldruck oder Malerei auf Papier, immer sind es vielschichtige, das Wesen des großen schwarzen Vogels umspielende Formfindungen, die einerseits die Leichtigkeit des Schwebens, andererseits die kompakte Schwere des Vogelkörpers vor Augen führen. In den Scherenschnitten greift sie einen früheren Ansatz, das Schattensammeln, wieder auf. Ihre frei erfundenen, gefiederten Formungen platziert sie so im Raum, dass das einfallende Licht neue Schatten und mit ihnen traumhafte Visionen hervorruft.
Die Gemälde frappieren durch ihre Unmittelbarkeit. Die Krähenformung bildet keine Vögel ab, wie sie in der Natur existieren, sondern erfasst die Natur dieser majestätischen Wesen, indem Formen dem lebendigen Vorbild intuitiv nachempfunden und bis zum Befremdlichen, manchmal sogar bis zum Grotesken übertrieben werden. Auf ein dunkel schillerndes Farbspektrum beschränkt, belegen diese Gemälde eindrücklich Kattlers koloristisches Talent und ihre technische Souveränität. Ein im Zusammenhang der ersten Exemplare dieses Werkkomplexes entstandenes Gedicht dokumentiert ihre Affinität zu Lyrik. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sie ab 2019 gemeinsam mit Danilo Pockrandt in selbst herausgegebenen Bänden der edition unbewohnt den Dialog von Sprache und Bild als künstlerische Ausdrucksform etabliert.
keine Farbe ist so
schwarz
wie tiefes Blau
bei Dämmerung
wenn der heisere
Krähenschrei
die Elster aufschreckt
und Äste brechen
Während die Krähen mittels Farbformung körperliche Plastizität erhalten, geht Vera Kattler in einem 2013 entstandenen großformatigen Gemälde mit dem Thema Tierverschwindung den umgekehrten Weg. Auf ebenso imponierende Weise entgleitet die Bildfigur formal in die streifigen Farblasuren, die ihrerseits in Auflösung begriffen sind. Auch bei einigen Krähen lässt sich dieses Phänomen einer formalen Demontage entdecken. Beide Tendenzen, die des Formaufbaus und die der Verflüchtigung, visualisieren Metamorphosen des Körperlichen und damit zeitliche Prozesse. Nichts bleibt so, wie es war.
Mit einem Augenzwinkern nimmt Kattler als Randerscheinung des Krähenprojektes die Exkremente von Vögeln ins Visier und veröffentlicht in ihrem Blog vier sparsam mit Ölfarbe bespritzte Blätter unter dem Motto Malerisches Nachdenken über die malerischen Möglichkeiten von Vogelkot. Eine ebenfalls eher untergeordnete Werkgruppe aus vielen einzelnen, fröhlich bunten Punkten fließender Farbmischungen in Aquarelltechnik kommentiert sie lakonisch: ich wusste schon immer, dass alles auf einen fleck hinausläuft. Humor ist eine ihrer Eigenschaften, die bei aller Lust am Makabren immer wieder durchblitzt.
So besitzen die 2014 in Ölfarbe oder Kohle ausgeführten Darstellungen der Reihe In den Wolken seh‘ ich immer Hunde, die sie als Gratwanderung „zwischen kitsch und grauen“ einstuft, einen geradezu bissigen Witz. Pareidolie, die Tendenz, in zufälligen Strukturen vertraute Dinge, vor allem Gesichter zu erkennen, gründet auf dem unbewussten Bestreben des menschlichen Gehirns, rudimentäre Wahrnehmungsmuster zu sinnvollen Formen zu ergänzen, wobei die Erwartung die Art der Trugbilder beeinflusst. In den Wolken Hunde mit flauschigem Fell zu identifizieren, erweist sich dabei als naheliegend. Während sich in den Ölgemälden auf Leinwand die Hundeporträts tatsächlich aus Farbschwaden herauskristallisieren, ist in den Schießscheibenbildern und Kohlezeichnungen die wolkenartige Disposition auf die Hunde selbst konzentriert. Vor allem die provokativ auf Schießscheiben platzierten Köpfe der treuen Vierbeiner haben es in sich: Die runde schwarze Zielmarkierung glorifiziert das Tier mit einer Art Nimbus und macht es dadurch gleichermaßen zum Opfer und Heiligen. Die melancholisch-sentimental inszenierte Melange aus Brutalität, Erschrecken und Mitleid geht ans Eingemachte. Mit technischer Finesse und Sinn für ästhetische Wirkmechanismen wagt Kattler sich in ihren Hundebildern bis zur Grenze des Rührseligen vor und lässt die Stimmung dadurch kippen, dass sie über Abweichungen vom Makellosen und herausfordernde Konfrontationen aggressive Neigungen bei Mensch und Tier bloßlegt.
Ab 2016 widmet sie ihre Aufmerksamkeit bedeutend kleineren und daher unauffälligeren Lebewesen, den Insekten, der mit fast einer Million Arten reichsten Klasse der Tiere überhaupt. Die meisten von ihnen sind harmlos, doch sind viele dieser Gliederfüßler dazu in der Lage, zu beißen oder zu stechen. Dann können sie lästig und auch gefährlich sein. Treten diese fragilen Geschöpfe in Schwärmen auf, werden sie zur Angst auslösenden Plage. In ihren zarten, in immenser Zahl produzierten und seriell in veränderlichen Konstellationen präsentierten Tuschemalereien, die sie unter dem poetischen Titel Vom Sammeln des Flügelschlags subsumiert, trägt Vera Kattler diesen Faktoren Rechnung. Die kleinformatigen Werke erzeugen in 1000-facher Variation einen pulsierenden Rhythmus. Die Tierchen entfalten sich aus der sich in einer wässrigen Lache ihren Weg bahnenden Tusche, wobei minimale Zugaben zusätzlicher, nicht unbedingt für den künstlerischen Gebrauch vorgesehener Materialien – Rotwein, Espresso, Tee, Caput mortuum oder Pigmente – Farbigkeit und Struktur der feinen, transparenten Flügelträger beeinflussen und dem Malergebnis eine experimentelle Note verleihen.
Aufgrund der größten Nähe zum Menschen evozieren vielleicht die zwischen 2015 und 2017 entstandenen Unklaren Verwandtschaften die stärkste Beklemmung, denn wir begegnen weder schönen noch freundlichen Gesichtern. Analog den Fliegen und Faltern sind diese Arbeiten nass in nass entstanden, auch hier ist der Zufall als Gestaltungselement bewusst einkalkuliert. Die Porträts, oft ohne unmittelbaren Blickkontakt zu den Betrachtenden, sind zu irrsinnigen, grotesken Fratzen verzerrt. Fusionen mit Animalischem oder Vegetabilem und Assoziationen an Totenschädel mit leeren Augenhöhlen betonen das Düstere, Abwegige, Furchterregende. Provokativ überschreiten diese Bildnisse die Grenzen eines Porträts und entfremden in surrealistischer Tradition das gegenständlich Erkennbare zunehmend ins Fantastische und Absurde. Welche verwandtschaftlichen Beziehungen liegen vor? Wie sieht es im anderen aus, wie in mir selbst? Und in welchem Ausmaß bin ich überhaupt in der Lage, es zu durchschauen? Manche der Köpfe wirken komisch, andere karikierend. Ohne die Neigung zum humorvollen Unterwandern wären diese gespenstigen Erscheinungen schwer zu ertragen.
An diese Folge schließt Kattler 2018/19 mit einer veränderten Motivreihe in einer für sie neuen, simplen Technik an, den im Tetrapackdruck auf Seidenpapier hergestellten Masken. Es handelt sich um Unikate in der Art von Monotypien. In mehreren Arbeitsschritten sind Abdrücke verschiedener Form und Größe im Zentrum des leeren Blattes zu einer frei schwebenden, ovalen Maske mit stilisierten menschlichen Gesichtszügen übereinandergelegt. Die verschiedenen Ausführungen erinnern an geschnitzte Masken, die bei rituellen Tänzen indigener Völker getragen werden, um Verbindung mit Geistern aufzunehmen. Auch im Theater gehören Masken zu den traditionellen Requisiten. Das Verbergen des Antlitzes einer Person unter dem abstrahierten Schild erleichtert einerseits Typisierungen und fördert andererseits obskure und dämonische Imaginationen. Auch in den Druckgrafiken ist das Mehrdeutige und Fiktive des Gegenübers, das sich einer klaren Einschätzung entzieht, künstlerisches Thema.
Ähnlichen Tendenzen gehen die 2020/21 als farbige Tusche-Collagen ausgeführten Masken nach, die teilweise zu ganzen Figuren oder, wie die Kohlezeichnungen der Tapire, zu Konglomeraten erweitert sind. Da schmelzen kuriose Einzelteile zu einem schrägen Konstrukt zusammen. Marionettenhaft tänzeln die collagierten Kreaturen in freien Kompositionen vor der Wandfläche, während die Tapire absurde Traumwelten vortäuschen. Alles in allem bietet sich uns ein Panoptikum höchst sonderbarer Gewächse und surrealer Transformationen.
Unter der Bezeichnung Möglichkeiten ordnet Kattler ihre feinen Zeichnungen ein, die ohne inhaltliche Vorgabe mit parallelen, kurzen Strichanordnungen aus einer zentralen Keimzelle strukturell wachsen. Ihr organisches Entwicklungspotenzial lässt Spielraum für alle denkbaren Entwicklungen und sehr unterschiedliche Interpretationen. Viele von ihnen sind in die Publikationen der 2019 selbst initiierten edition unbewohnt aufgenommen.
Die letzte, 2022 begonnene Serie Nachts unterm Futterplatz mit Totenblumen basiert auf nächtlichen Momentaufnahmen einer Wildkamera. Zu den Intentionen ihrer Arbeit äußert sich die Künstlerin selbst:
Was passiert nachts unterm Futterplatz?
Die Wildkamera enthüllt es und erklärt doch nichts,
denn sie sieht nicht alles ...
Die frei nach ihren Aufnahmen entstandenen Kohlezeichnungen,
entfernen sich von Blatt zu Blatt mehr und mehr von der Realität,
wirken teilweise wie aus einem unruhigen Traum gelöst.
In malerischen Momenten verbindet sich das Tier nahezu mit der Dunkelheit,
wird gewissermaßen selbst zur Nacht.
Der direkt auf den Betrachter gerichtete Blick und die verfremdete Gestalt des anfangs vielleicht noch niedlich wirkenden Tieres rufen bisweilen beunruhigende Momente hervor.
Außerdem eröffnen die oft abwegig gewählten Titel neue Zusammenhänge.
Geheimnisvolle Gedankenwelten tun sich auf, vielleicht …
Die Fotografien der Wildüberwachungskamera sind in subtil verwischten Zeichnungen von malerischem Charakter mit Kohle auf Papier im DIN A4-Format frei ins Fantastische weiterentwickelt. Die hungrigen, in der Regel kurzzeitig an der Futterstelle anwesenden Gäste leuchten spukhaft vor der unheildrohenden Kulisse eines unergründlichen Dunkels. Mal ist ein Tier ganz, mal im Vorbeihuschen lediglich partiell fixiert. In der Umgebung lauernde Phantome laden die Atmosphäre dämonisch auf. Eigentümliche Titel wie z. B. Manche Fragen wollen keine Antwort, Die Kälte kroch mit mir oder Totenstrauß verschlimmern das Gruseln noch. Zudem machen bis aufs Skelett abgemagerte Körper und das angsteinflößende Aufblühen von Totenschädeln keinen Hehl aus dem nahenden Ende. Die schemenhaften Wesen lassen sich als Erscheinungen aus anderen Wirklichkeiten begreifen, wie sie aus der Romantik und dem Surrealismus, vor allem aber aus den Radierfolgen Goyas bekannt sind.
Eingebunden in die kunsthistorische Tradition und doch ganz unverwechselbar, mit Bravour und bemerkenswerter Konsequenz entwickelt Vera Kattler in ihren am Gegenständlichen orientierten, seriellen Werkkonzepten aus den Bildmotiven heraus Varianten vorstellbarer Wahrscheinlichkeiten. Dabei verhindern Undurchschaubarkeit und Ambivalenz eine leichtfertige Interpretation. Ihre verstörenden, eine Mischung aus Faszination und Schauder evozierenden Metamorphosen hinterfragen kritisch unseren Umgang mit der Präsenz des Anderen und unser Bewusstsein vom Fremden in uns.
Petra Wilhelmy
Biografie
-
1965geboren in Wadgassen/Saar
-
1999–2005Studium der Freien Kunst an der Hochschule der Bildenden Künste Saar bei Prof. Bodo Baumgarten und Prof. Daniel Hausig
-
2004Nominierung zum Kunstpreis Robert Schuman
-
2005Diplom mit Auszeichnung bei Prof. Daniel Hausig im Fachbereich Mixed Media/Malerei, Meisterschülerin von Prof. Daniel Hausig
-
Kulturpreis des Stadtverbandes Saarbrücken
-
2008Förderstipendium der Landeshauptstadt Saarbrücken
-
2011Stipendium Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf, Brandenburg
-
2012/13Stipendium artmix 7, Deutsch-Luxemburgischer Künstler*innenaustausch
-
2017Nominierung zum Kahnweiler Preis „Arbeiten auf Papier 2017“
-
lebt und arbeitet in Saarbrücken und Püttlingen
Mitgliedschaften
- Deutscher Künstlerbund
Einzelausstellungen
-
2004"SCHWEINE!", Kulturamt, Saarbrücken
-
"KochKunst & EssKultur", Prolog zur Bliesgau-Lammwoche, K4 forum, Saarbrücken
-
2008"Seltsam vertraut", Kulturfoyer, Kulturamt, Saarbrücken
-
2009"Phänomene des Anderen", Sommerforum 2009 Malerei vis-à-vis mit Igor Dörge, Stadtmuseum St.Wendel (K)
-
2010"…was schaut zurück?", Galerie Besch, Saarbrücken
-
2011"Wechselbalg – Tanja Holzer-Scheer & Vera Kattler", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken (K)
-
"Phänomene des Anderen", Kunstverein Norden e. V., Kunsthaus Norden
-
2012"Das kleine Monströse", Kunstverein Trier Junge Kunst e. V., Trier
-
"Thomas Peter. Holzschnitt + Objekte – Vera Kattler. Malerei + Zeichnung", Kunstverein zu Frechen e. V.
-
"einblicke – 12-Tage-Atelier von Vera Kattler und Tanja Holzer-Scheer", Bahnhofstraße 68, Saarbrücken
-
2013"nahezu menschlich", Kunsthaus Frankenthal
-
"Wechselbalg – Tanja Holzer-Scheer & Vera Kattler", Kunstverein Wesseling
-
2014"– befremdlich –", Kunstverein Nordenham
-
"Krähenformung", Kunstverein Biberach an der Riß
-
2015"Krähenformung", Museum Schloss Fellenberg, Merzig
-
"weitermalen – drei malerische Handschriften" (mit Gudrun Emmert und Mathias Weis), Kunstagentur Karin Melchior, Kassel
-
2018"Krähenformung", Kunstverein Norden e. V., Kunsthaus Norden
-
"Vom Sammeln des Flügelschlags", Meppener Kunstkreis e. V., Meppen
-
2019"Lebte die Seife?" (mit Danilo Pockrandt), KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken (K)
-
2022"Mögliche Merkwürdigkeiten", Schauraum am Laboratorium, Saarlouis (K)
-
2024"zart und reißfest", Kunstverein Unna, mit Anne Haring
Ausstellungsbeteiligungen
-
2003"YTIC", HBKsaar, Kunstparcours Völklingen
-
2004"Kunstszene Saar 2004 – Im Augenblick", Landeskunstausstellung, Museum Schloß Fellenberg, Merzig (K)
-
"Zoom 2004", T-Systems Saarbrücken (K)
-
2005"Aus der Serie 3", Galerie K4, Saarbrücken
-
"Kunstpreis Robert Schuman / Prix d' Art Robert Schuman", Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken (K)
-
2006"Natur-Mensch", 12. Kunstausstellung 2006, Nationalpark Harz, St. Andreasberg (K)
-
"Von hier aus", Frauenkulturmonat, Ministerium der Finanzen, Saarbrücken
-
2007"Das inszenierte Fenster in der nächtlichen Stadt", Saarbrücken (K)
-
2008"Dein Land macht Kunst", Landeskunstausstellung, Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken (K)
-
"Artig saraviensis" Galerie Besch, Saarbrücken
-
Videofestival "Octobre Rouge", Esch-sur-Alzette, Luxemburg/LU
-
2010"Les Secteurs", Museum im Kulturspeicher Würzburg
-
"Animal Art", Kunstverein Schwetzingen / Kunstverein Worms (K)
-
2011"tierisch", Große Kunstausstellung München, Haus der Kunst, München (K)
-
"Herbstsalon 2011", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2012"Herbstsalon 2012 – 5 Jahre KuBa", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2013"artmix 7", Deutsch-luxemburgischer Künstler*innenaustausch, KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
"SaarART 2013", Zehnte Landeskunstausstellung, Museum St. Wendel
-
"Herbstsalon 2013", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
"Herbstsalon 2014", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2015"imago mundi", Luciano Benetton Collection, Fondazione Giorgio Cini, Venedig/IT (K)
-
"Heldenmythen – Heldentaten – Heldentod", Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken (K)
-
"Herbstsalon 2015", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2016"Der will nur spielen – Der Hund in der aktuellen Kunst", Kunstraum Neureut e. V., Karlsruhe-Neureut
-
"1. Walter Bernstein Kunstpreis für Malerei", Zechenhaus Reden, Schiffweiler (K)
-
"Suezzo – 17 Künstler/innen zum 1250. Geburtstag der Stadt", Kunstverein Schwetzingen e. V., Schlossorangerie, Schwetzingen (K)
-
"Herbstsalon 2016", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2017"Naturliebe – erneuerbare Haltungen", Künstlerverein Walkmühle e. V., Wiesbaden (K)
-
"Saarart11", Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken (K)
-
"Kahnweiler-Preis 2017 – Arbeiten auf Papier", Museum für Kunst, Rockenhausen
-
"Herbstsalon 2017", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2018“Herbstsalon 2018”, KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2019"Transposition 2", Saarländisches Künstlerhaus zu Gast in der Tuchfabrik Trier und Galerie Junge Kunst, Kunstverein Trier Junge Kunst, Trier (K)
-
"Herbstsalon 2019", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
2020"Letzte Lockerung", Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken (K)
-
2022"Herbstsalon 2022", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
-
"Kahnweiler-Preis 2022 – Arbeiten auf Papier", Museum für Kunst, Rockenhausen (K)
-
2023"Jamboree", Mitgliederausstellung, Saarländisches Künstlerhaus, Saarbrücken (K)
-
"Herbstsalon 2023", KuBa – Kulturzentrum am EuroBahnhof, Saarbrücken
Werke in Sammlungen
- Landeshauptstadt Saarbrücken
- Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes, Saarbrücken
Bibliografie: Eigene Schriften
- Vera Kattler: ... in den Wolken seh' ich immer Hunde. 2014. https://issuu.com/verakattler/docs/in_den_wolken_seh_ich_immer_hunde
- Vera Kattler: Krähenformung. 2015. Mit Textbeiträgen von Bernhard Wehlen: "Krähenformung", S. 4–12; Petra Wilhelmy: Krähenformung, S. 75. https://issuu.com/verakattler/docs/kr__henformung_2015
- Klaus Harth, Vera Kattler, Christoph Rammacher: Zeichengeber. Books on Demand. 2015
- Matthias Rürup: Igel-Gesänge. Wie kann man nur lieben? Bilder von Vera Kattler. Vechta 2019
- Vera Kattler, Danilo Pockrandt: Lebte die Seife? Zeichnung: Vera Kattler. Kurze Prosa: Danilo Pockrandt. edition unbewohnt Bd. 1. Books on Demand. 2019
- Vera Kattler, Danilo Pockrandt: Das Meer klingt wie tausend Chipstüten beim Abendprogramm. Ein Nordseedialog. Gedichte: Vera Kattler, Danilo Pockrandt. edition unbewohnt Bd. 2. Books on Demand. 2020
- Vera Kattler, Danilo Pockrandt: Hatte ich mich wie ein Geist bewegt? Zeichnung: Vera Kattler. Kurze Prosa: Danilo Pockrandt. edition unbewohnt Bd. 3. Books on Demand. 2020
Bibliografie: Monografien
- Vera Kattler. Phänomene des Anderen. Sommerforum 2009 Malerei vis-à-vis mit Igor Dörge. Stadtmuseum St. Wendel 2009. Mit einem Textbeitrag von Werner Brück: Phänomene des Anderen
- Vera Kattler. Das kleine Monströse. Ausstellung Wechselbalg. Tanja Holzer-Scheer & Vera Kattler. Saarbrücken 2011. Mit Textbeiträgen von Petra Wilhelmy: "Das kleine Monströse" und Petra Wilhelmy: Wechselbalg
- Vera Kattler. Krähenformung. artmix 7. Künstleraustausch in Luxemburg und Saarbrücken 2012/2013. Teil 1 von 4: Vera Kattler, Chantal Maquet, Alexander Minor, Letizia Romanini. Saarbrücken 2013. Mit einem Textbeitrag von Mirjam Bayerdörfer: Auge um Auge
- Andreas Bayer (Hg.): Vera Kattler. Mögliche Merkwürdigkeiten. Broschüre zur Ausstellung im Forschungszentrum für Künstlernachlässe am Institut für aktuelle Kunst im Saarland. Saarlouis 2022. Mit einem Textbeitrag von Andreas Bayer: Zur Ausstellung
- Andreas Bayer (Hg.): Künstler*innenlexikon Saar Künstlerinnenblatt Vera Kattler. Saarlouis 2023. Mit einem Textbeitrag von Petra Wilhelmy: Vera Kattler. Die Präsenz des Anderen
Bibliografie: Sammelschriften
- Kunstszene Saar 2004 – Im Augenblick. Landeskunstausstellung. Saarbrücken 2004, S. 70 f.
- Zoom 2004. T-Systems Saarbrücken. Saarbrücken 2004, S. 58–61
- Kunstpreis Robert Schuman / Prix d'Art Robert Schuman. Saarbrücken 2005, S. 56–61
- Natur-Mensch. 12. Kunstausstellung 2006. St. Andreasberg 2006, S. 58
- Hochschule der Bildenden Künste Saar 2003–2006. Hg. Ivica Maksimovic. Saabrücken 2006, S. 181
- Das inszenierte Fenster in der nächtlichen Stadt. Saarbrücken 2007, S. 84-87
- Dein Land macht Kunst. Landeskunstausstellung 2008. Saarbrücken 2008, S.148 ff.
- Animal Art. Ausstellung Kunstverein Schwetzingen / Kunstverein Worms 2010, S.12 f., 52 f., 77
- tierisch. Große Kunstausstellung München. Münchner Secession. München 2011, S. 78
- SaarART 2013. Zehnte Landeskunstausstellung. Band 1. Hg. Andreas Bayer. Saarbrücken, S. 222 f.
- SaarART 2013. Zehnte Landeskunstausstellung. Band 2. Hg. Andreas Bayer. Saarbrücken, S. 151, 153
- Mappa dell’arte nuova. Imago Mundi, Luciano Benetton Collection. Treviso 2015
- Heldenmythen – Heldentaten – Heldentod. Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e.V. Saarbrücken 2015
- Walter Bernstein. Heimkehr und Hommage anlässlich des 115. Geburtstags mit dem 1. Walter Bernstein Kunstpreis für Malerei. Hg. Förderstiftung Walter Bernstein. Begleitheft zur Ausstellung. Schiffweiler 2016, S. 30 f.
- Suezzo. 17 Künstler/innen zum 1250. Geburtstag der Stadt. Hg. Dietmar Schuth, Kunstverein Schwetzingen e. V. Schwetzingen 2016, S. 14 f.
- Naturliebe – erneuerbare Haltungen. Hg. Künstlerverein Walkmühle e. V. Wiesbaden 2017, S. 78–81
- Vera Kattler. Unklare Verwandtschaften. In: Saarbrücker Hefte Nr. 115/116. Sommer 2017, S. 64–69 und Titelblatt. Mit einem Textbeitrag von Bernhard Wehlen: Unklare Verwandtschaften. Von Vera Kattler, S. 64
- 10 Jahre KuBa – Kulturzentrum am Eurobahnhof 2007–2017. Saarbrücken 2017, S. 157
- Saarart11. Hg. Museum St. Wendel, Stiftung Dr. Walter Bruch. St. Wendel 2017, S. 146 f. Mit einem Textbeitrag von Bernhard Wehlen, S. 146
- Günter Scharwath: Das große Künstlerlexikon der Saar-Region. Biografisches Verzeichnis von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern der Saar-Region aus allen Fachrichtungen und Zeiten. Saarbrücken 2017, S. 496
- Transposition 2. Austauschausstellung Saarbrücken – Trier. Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e. V., Kunstverein Trier Junge Kunst. Saarbrücken 2019, S. 25, 36 f., 46
- Letzte Lockerung. Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e.V. Saarbrücken 2020
- Kahnweiler-Preis 2022. Arbeiten auf Papier. Broschüre zur Ausstellung im Museum für Kunst. Rockenhausen 2022
- Jamboree. Hg. Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e. V. Saarbrücken 2023
Homepage / Quelle
- Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Archiv, Bestand: Kattler, Vera (Dossier 9964)
- https://vera-kattler.de/
- https://verakattler.blogspot.com/
Redaktion: Petra Wilhelmy
Alle Abbildungen: VG Bild-Kunst, Bonn