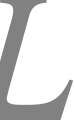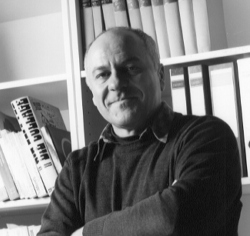Sigurd Rompza: Bildentwicklung aus dem Quadrat, 1977/78, Kunststoff, Holz, Acryl, weiße Farbe, 50 x 50 x 5 cm. Foto: Franz Mörscher
Sigurd Rompza: Bildentwicklung aus dem Quadrat, 1977/78, Kunststoff, Holz, Acryl, weiße Farbe, 50 x 50 x 5 cm. Foto: Franz Mörscher
 Sigurd Rompza: Systematische Reliefstruktur/Bildentwicklung aus dem Quadrat, 1980, Sperrholz, Acryl, 48 x 48 x 6 cm. Foto: Georg Jost
Sigurd Rompza: Systematische Reliefstruktur/Bildentwicklung aus dem Quadrat, 1980, Sperrholz, Acryl, 48 x 48 x 6 cm. Foto: Georg Jost
 Sigurd Rompza: Öffnung, 1987-16, Acryl und Lack auf Aluminium, ca. 57 x 72 x 16 cm. Foto: Ingeborg Knigge
Sigurd Rompza: Öffnung, 1987-16, Acryl und Lack auf Aluminium, ca. 57 x 72 x 16 cm. Foto: Ingeborg Knigge
 Sigurd Rompza: Rot – Rot, 1988-10, 1999 übermalt und Farben geändert, Acryl und Lack auf Aluminium, 65 x 65 x 60 cm. Foto: Ingeborg Knigge
Sigurd Rompza: Rot – Rot, 1988-10, 1999 übermalt und Farben geändert, Acryl und Lack auf Aluminium, 65 x 65 x 60 cm. Foto: Ingeborg Knigge
 Sigurd Rompza: Lanzarote, 1996-3, Acryl und Lack auf Aluminium, 150 x 54 x 7 cm. Foto: Carsten Clüsserath
Sigurd Rompza: Lanzarote, 1996-3, Acryl und Lack auf Aluminium, 150 x 54 x 7 cm. Foto: Carsten Clüsserath
 Sigurd Rompza: Zeichnung mit Farbstift, 1997-45, Acryl auf Holz, 22,5 x 12,5 x 12,5 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Zeichnung mit Farbstift, 1997-45, Acryl auf Holz, 22,5 x 12,5 x 12,5 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Orange dominant II, 1998-30, Acryl und Lack auf Aluminium, 49 x 64 x 7 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Orange dominant II, 1998-30, Acryl und Lack auf Aluminium, 49 x 64 x 7 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Für Jean Goren, 2000-24, Acryl und Lack auf Aluminium, 40 x 63 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Für Jean Goren, 2000-24, Acryl und Lack auf Aluminium, 40 x 63 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Schwer und leicht, 2002-6, Acryl und Lack auf Aluminium, 42 x 53 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Schwer und leicht, 2002-6, Acryl und Lack auf Aluminium, 42 x 53 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2003-11, Acryl und Lack auf MDF, 60 x 15 x 3 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2003-11, Acryl und Lack auf MDF, 60 x 15 x 3 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2004-1, Acryl und Lack auf MDF, 120 x 30 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2004-1, Acryl und Lack auf MDF, 120 x 30 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Zeichnungen, 2005-2006, Acryl und Lack auf MDF, 15 x 45 x 3 cm, 30 x 90 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Zeichnungen, 2005-2006, Acryl und Lack auf MDF, 15 x 45 x 3 cm, 30 x 90 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2006-41, Acryl und Lack auf MDF, 96 x 16 x 15 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2006-41, Acryl und Lack auf MDF, 96 x 16 x 15 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2006/2010-17, Acryl und Lack auf MDF, ca.50 x 16 x 14 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2006/2010-17, Acryl und Lack auf MDF, ca.50 x 16 x 14 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2007-38, Acryl und Lack auf MDF, ca. 30,5 x 92 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2007-38, Acryl und Lack auf MDF, ca. 30,5 x 92 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Modellierung, 2010-10, Acryl und Lack auf MDF, 40 x 120 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Modellierung, 2010-10, Acryl und Lack auf MDF, 40 x 120 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2012-22, Acryl und Lack auf MDF, 48 x 32 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2012-22, Acryl und Lack auf MDF, 48 x 32 x 5 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2012-24, Acryl und Lack auf MDF, 24 x 24 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2012-24, Acryl und Lack auf MDF, 24 x 24 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2012-26, Acryl und Lack auf MDF, 32 x 32 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
Sigurd Rompza: Farb-Licht-Modulierung, 2012-26, Acryl und Lack auf MDF, 32 x 32 x 4 cm. Foto: Dirk Rausch
 Sigurd Rompza: Mobile Hängeplastik, 1988, Rundrohre aus Aluminium, Höhe ca. 8 m, Treppenhaus, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Goebenstraße 40, Saarbrücken. Foto: Archiv Institut für aktuelle Kunst
Sigurd Rompza: Mobile Hängeplastik, 1988, Rundrohre aus Aluminium, Höhe ca. 8 m, Treppenhaus, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Goebenstraße 40, Saarbrücken. Foto: Archiv Institut für aktuelle Kunst
 Sigurd Rompza: Reliefstruktur, 1989, Aluminium, weiß lackiert, 270 x 728 x 24 cm, Gebäude A 5, 1. Untergeschoss, Hörsaal-Foyer, Universität des Saarlandes, Campus Saarbrücken. Foto: Archiv Institut für aktuelle Kunst
Sigurd Rompza: Reliefstruktur, 1989, Aluminium, weiß lackiert, 270 x 728 x 24 cm, Gebäude A 5, 1. Untergeschoss, Hörsaal-Foyer, Universität des Saarlandes, Campus Saarbrücken. Foto: Archiv Institut für aktuelle Kunst
Rompza, Sigurd
geboren 1945 in Bildstock/Saar
lebt und arbeitet in Neunkirchen/Saar
Kategorien: Malerei, Grafik, Bildhauerei, Kunst im öffentlichen Raum
Künstler und Werk
Sigurd Rompza - das Konzeptionelle in sinnlicher Hinsicht
Wohl kaum eine Richtung innerhalb der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts hat derart ausformulierte wissenschaftlich-analytische Forschungsansätze entfaltet wie die Konkrete Kunst.
In ihrer 1930 im Gründungsmanifest der Gruppe "Art concret" definierten programmatischen Orientierung bezeichnet die Konkrete Kunst eine Kunstrichtung, die im Wesentlichen auf mathematisch-geometrischen Grund-lagen beruht. Sie versteht sich nicht als abstrakt, da sie nichts in unserer materiellen Realität Vorhandenes abstrahiert, sondern im Gegenteil Geistiges materialisiert. Die Konkrete Kunst strebt hierbei keinerlei inhaltliche oder symbolische Bedeutung an und grenzt sich in der Moderne von Konstruktivismus und abstrahierenden Tendenzen durch einen wissenschaftlich-analytisch geprägten Ansatz ab. Es ist also ein forschender Ansatz, der seine Schwerpunkte in der Untersuchung geometrischer Gesetzmäßigkeiten, in der Interaktion von Form und Farbe, von Fläche und Raum formuliert.
In diesem Sinne entwickelt die Konkrete Kunst eine ästhetisch-künstlerische Grundlagenforschung, bei der die künstlerische Praxis wesentlicher Bestandteil sowohl des Forschungsprozesses als auch der Forschungsergebnisse darstellt.
Im Gegensatz zu wissenschaftlicher Forschung über Kunst integriert die Konkrete Kunst die künstlerische Handlung als konzeptuelles Forschungsinstrument, geht hiermit über die reine Kunstproduktion hinaus und generiert eine Haltung, bei der zwischen Theorie und Praxis in der Kunst kaum ein wesentlicher Unterschied besteht.
Die Untersuchung und Darstellung von sinnlichen Potenzialen - in Abgrenzung von den an einem mathematisch orientierten Formalismus ausgerichteten Tendenzen der Konkreten Kunst - ist ein zentrales Thema in der künstlerischen Arbeit von Sigurd Rompza. Seine Konzepte und theoretischen Äußerungen, seine Erfahrungen und Auffassungen sind auf das engste mit seiner künstlerischen Praxis verwoben. Innerhalb der künstlertheoretischen Schriften der Konkreten Kunst weisen die Überlegungen von Sigurd Rompza hohe substanzielle Dichte und sprachliche Klarheit auf. Seine künstlerischen Arbeiten können gleichsam als Materialisierung der theoretischen Prozesse verstanden werden. Vorrangig thematisiert er "Abläufe und Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung" (8 x Konkret, 2007, S. 19), insbesondere das Sehen, und untersucht hierbei die Funktionalität sinnlich basierter Erkenntnisvorgänge. Somit ist das Kunst-Machen bei Sigurd Rompza grundsätzlich reflexiv. Neben dem analytischen Aspekt ist immer auch in besonderem Maße die sinnlich-anschauliche Dimension der Arbeiten von Sigurd Rompza zu betonen. Dies wird deutlich wenn er selbst formuliert: "mich interessiert nicht so sehr, dass meine künstlerischen arbeiten als konkret bezeichnet werden, sondern viel wichtiger ist mir an ihnen der aspekt des konzeptionellen in sinnlicher realisierung." (Rompza, 2011, S. 16)
In der Reduktion auf elementare Farbstellungen und minimalistisch anmutende formale Konstellationen entwirft der Künstler eine Art "Fundamentalalgebra" anschaulicher Relationen. Insofern lassen sich die Arbeiten Sigurd Rompzas als ausdifferenzierte künstlerische Experimentalsysteme begreifen, als durchdacht hergestellte Wahrnehmungskonstellationen, die ein nicht statisch verstandenes, polyvalentes Sehen aktivieren. Die künstlerischen Arbeiten als Ergebnis artikulieren hierbei das im theoretischen und praktischen Forschungsprozess erworbene Wissen und fungieren gleichsam als Paradigmen der Wahrnehmung.
1972 entstehen erste weiße Reliefs, 1974 quadratische Reliefs mit Elementen, die nach mathematisch-systematischen Verfahren angelegt sind. Die bereits hier vorgenommene Schattenbildung sowie die Visualisierung von Lichtphänomenen dokumentieren ein Interesse an der Artikulation von Licht, das im Werk immer wieder thematisch wird und sich auch in den gegenwärtigen Arbeitsprozessen erhalten hat. Daneben entwickelt Sigurd Rompza Bildgestaltungen mit Vierkantstäben, die seriell auf Quadratflächen angeordnet sind. 1977 entsteht die Reliefserie "bildentwicklung aus dem quadrat", bei der aus der quadratischen Fläche, orientiert an Einschnittlinien, Umklappungen vorgenommen werden, sodass sich überlagernde Winkelbänder entstehen, die Gerichtetheit und Dynamik in die Reliefsituation einbringen.
Geometrisierende Kompositionsverfahren mit auf der Permutation von Zahlenfolgen basierender Gestaltung bleiben in den Arbeiten der späten 1970er und frühen 1980er Jahre präsent. Die Serie der "Stegreliefs" markiert hierbei einen Wandel, bei dem "die abkehr von den mathematisch-systematischen verfahren zwar noch nicht im aspekt der herstellung, jedoch bereits im aspekt der darstellung vollzogen" wird. Die "Stegreliefs" arbeiten bereits mit jener "multivalenz der beziehungen der bildelemente", die in nachfolgenden Werkgruppen bestimmend wird. (Rompza, 2011, S. 13) Eine Uneindeutigkeit als ästhetische Fragestellung wird hier formuliert, die die Erscheinung des Kunstwerks, abhängig von der Betrachterbewegung und den spezifischen Lichtverhältnissen, zwischen räumlich-reliefhafter Darstellung und bildhaft-malerischer Anmutung changieren lässt.
Mit dem Verzicht auf die Trägerplatte und dem direkten Bezug zur Wand als Grundfläche, auf der sich seine Arbeiten entfalten, entwickelt Sigurd Rompza ab 1985 offene Bildformen, die, obschon sie in engem Zusammenhang mit den Arbeiten der 1970er Jahre zu sehen sind, erweiterte ästhetische Aspekte erschließen. Indem die das Werk in seinen Dimensionen definierende Träger- bzw. Rahmenfläche entfällt, werden Potenziale einer freieren, entgrenzenden Objektartikulation an der Wand eröffnet, bei der die Werke gleichermaßen als raumbildend und raumaktivierend wirksam sind, als räumlich aufzufassende Gebilde wie auch als sich an der Fläche vollziehende Kompositionen.
Zunächst mit Vierkant- später dann mit Rundstäben, in verschiedenen Winkelstellungen zueinander und zur Wand, und unter dem bewusst reflektierten Einsatz von Farbe entwickelt Sigurd Rompza Bildsituationen, in denen das systematisch-forschende Bemühen anschaulich wird, Farbe und Form unabhängig und jenseits allgemeiner gegenstandsgebundener Abbildungsabsicht zu realisieren.
Dabei entstehen integrative Form-Raum-Farbbeziehungen, die in der Durchdringung der bildnerischen Elemente polyvalente Wahrnehmungsprozesse initiieren. Im Rahmen der gestaltenden Handlung werden nichtrationale, künstlerische Fragestellungen thematisch, deren Forschungsanliegen im Bereich der sinnlichen Erkenntnisgewinnung zu verorten ist. Bei dem Raum, den Sigurd Rompza in seinen Arbeiten visualisiert, "handelt es sich nicht um einen physikalischen raum, vielmehr um einen künstlerischen." (Rompza, 2011, S. 13)
Die Farbe ist nicht lediglich physikalische Substanz und ausschließlich an den Gegenstand gebunden. Vielmehr eignet ihr eine gewisse Potenzialität, indem Licht und Beleuchtung sowie die Bewegung des Betrachters ihre Erscheinung variieren lassen und indem auch der Schattenwurf an der Wand farbige Anteile enthalten kann. Die "Öffnung" des Bildformats ab Mitte der 1980er Jahre beinhaltet zudem die von den Objekten hervorgebrachte Schattenlinienzeichnung an der Wand als simultanen Bestandteil der Arbeit. Das Werk erschöpft sich somit nicht in seiner plastisch-materiellen Organisation, sondern geht darüber hinaus und gewinnt zusätzliche räumliche und farbige Aspekte.
Die mit den "Stegreliefs" eingeleitete Entwicklung verdichtet sich zum Ende der 1980er Jahre, indem die sinnliche Analyse in der Arbeit von Sigurd Rompza eine verstärkte Gewichtung erfährt.
Diesen Prozess beschreibt Matthias Bleyl allgemein als Tendenz der Konkreten Kunst, "außer dem Postulat der Faktizität ihrer Phänomene auch deren Optizität zu berücksichtigen und in die Konzeption einzubeziehen. Es reicht demzufolge nicht mehr, das Werk lediglich im Geist vorzukonzipieren (…), sondern gerade die bislang kaum berücksichtigte Sinnlichkeit, also die aktive Rolle des Auges, zu fordern. Der reinen Systematik der früheren konkreten Kunst, die dazu neigte, logische Gesetzmäßigkeiten in der Kunst zu realisieren, wird heute die Analyse entgegengesetzt bzw. hinzugefügt." Eine verstärkte Akzentuierung "auf reflektierter Analyse unter Einschluss sinnlicher Kontrolle" spricht sich auch in den Überlegungen von Sigurd Rompza aus, wenn er formuliert: "aufgrund der erkenntnis, dass das mathematisch richtige und somit logische keineswegs immer in ästhetischer hinsicht befriedigt, d.h. unser sehen gesetzmäßigkeiten folgt, die zum teil in widerspruch zu physikalischer wirklichkeit stehen, erfolgt nun bewusst die unterordnung systematischer gestaltungsmethoden unter gesetzmäßigkeiten des sehens." (Matthias Bleyl: Form und Farbe - Farbe und Form: Konkrete Farbformen heute. In: Form und Farbe - Farbe und Form: Konkrete Farbformen heute, hg. von Bernd Schulz und Matthias Bleyl, Saarbrücken 1988, S. 10, 11).
"sehen meint", so Rompza, "etwas einen sinn zumessen, etwas sinnhaft machen." Um diese Sinnhaftigkeit nun prägnant und treffend künstlerisch zu formulieren, erfolgt in den Arbeiten des Künstlers "die pikturalsprachlich relevante auswahl exemplifizierend in der absicht, sehen zu aktivieren." "beim bildkünstlerischen Arbeiten gilt es, mit der ‚natur des sehens‘ zu arbeiten. ‚natur des sehens‘ bedeutet, wie sehen passiert. der akt des sehens ist nicht statisch, sondern vollzieht sich in bewegung. es entsprechen ihm multivalenz der beziehung von bildelementen, mediale doppeldeutigkeit, sich ändernde räumlichkeiten, farb-form-beziehungen und offene bildformen. auf sehen hin konzipierte künstlerische objekte erlauben ein produktives sehen, d.h. form zu sehen, farb-bewegungen zu sehen, licht, schatten, innen als außen und umgekehrt zu sehen. dies sowohl in kombination als auch selektierend." (Rompza 2011, S. 15)
Unter dieser Zielsetzung entstehen "Sehstücke" - Objekte, die den sinnlichen Prozess des Sehens und die bewusste, gleichermaßen analytische wie auch erkennende Betrachtung thematisieren. (Rompza 2011, S. 80)
In diesem Kontext kommt den "Farb-Licht-Modulierungen", die als zunächst weißgrundige Reliefs mit lichten, pastellhaften Farbelementen ab dem Jahr 2002 entstehen, eine besondere Bedeutung zu. Waren zuvor Verortung und Ausbreitung der Farbe innerhalb des Objekts formal und strukturell jeweils an ein "Glied" der Komposition gebunden, was eine weitest gehende Identität der Farb-Form-Relation beinhaltete, so übergreift nun die homogen gehaltene Farbfläche den Grat des Reliefs und erfährt hierdurch eine Variation in der Erscheinung ihrer Lichtwerte. Der Reliefgrat definiert die Trennlinie von Licht- und Schattenseite des Objekts, in dem "licht und schatten im relief dieselbe farbe je anders zur erscheinung bringen." Indem "die farbe und das weiß sowohl anteil an der licht- als auch an der schattenseite des reliefs" haben, wird "der schatten (…) nicht gemalt, sondern real erzeugt." Phänomenologisch wird so dieselbe Farbe "auf der lichtseite (…) heller als auf der schattenseite wahrgenommen und erscheint auch hinsichtlich farbrichtung und sättigung verändert. zwei farben, das weiß mit berücksichtigt, erscheinen wie vier (…)." (Rompza 2011, S. 25-31)
Um die Variationsmöglichkeiten dieses gestalterischen Verfahrens als bildnerische Aufgabenstellung in ihrer Breite anschaulich zu machen und zu erforschen, arbeitet Sigurd Rompza mit dem Prinzip der Serie. Dabei werden, hinsichtlich der Reliefs, Werkgruppen mit gemeinsamen formalen Konstanten entwickelt, innerhalb derer sich Variationen entfalten, wie z.B. der Einsatz unterschiedlicher Farben oder auch die je verschiedene kompositionelle Orientierung der Farbstellung im Bezug auf den Reliefgrat. So wird das Bezugssystem von Farbe und Licht im Kontext seiner Modulierungspotenziale in sinnlicher Analyse artikuliert und anhand der Reliefs in besonderer Weise forschend visualisiert.
Die "Farb-Licht-Modulierungen" führt Sigurd Rompza in verschiedenen Farb- und Formvariationen fort. Es werden gesättigte Farben eingesetzt, die anfänglich verwendete hochrechteckige Reliefform wird abgelöst von einem dem ästhetischen Anlass jeweils angemessenen Format. Die Kombina-tion von Reliefgrat und dieser über-greifender Farbsituation stiftet beim Rezipienten eine produktive Irritation, die ein reflektiertes Sehen anregt.
In einer Werkgruppe, die seit Anfang 2012 entsteht, gewinnt der Künstler über Versuche mit prozessual in verschiedenen Winkelstufen umbrechenden Reliefgraten auch die Rundung als Instrument der ästhetischen Handlung. Frühere Problemstellungen des polyvalenten Sehens werden dabei aufgegriffen und als "Farb-Licht-Modulierung" auf andere Weise gezeigt.
Zum Teil bilden die objekthaften Arbeiten an der Vorderseite eine Fläche, die an den seitlichen Rändern in einer Rundung nach hinten zur Wand geführt wird. Der Einsatz von Farbe vollzieht sich hier unter Verwendung der je gleichen Farbe in unterschiedlichen Erscheinungsqualitäten. Hochglänzender Lack steht im Wechselverhältnis zu matten Bereichen. Diese Elemente entfalten sich, proportional verschieden dimensioniert, in horizontaler Orientierung an den Objekten. Es sind in materiell-formaler Hinsicht gleichsam "Bänder", die die Objekte umlaufen und diese so strukturieren. In der Konstellation von aufglänzenden und matten Bildbereichen ist ein uneindeutig-changierendes Raumverhältnis latent. Bisweilen tritt in der Betrachtung das Matte nach vorne, bisweilen scheint eine Akzentuierung auf dem glänzenden Element zu liegen. Das Zueinander der Bildkonstituenten ist nicht abschließend zu beschreiben. Es bleibt in der Schwebe. Jenseits des materiell-formalen Moments generieren die Phänomene, die sich in der Betrachtung an diesen Objekten vollziehen, zusätzliche struktive und sinnlich bestimmte Aspekte.
Durch den Einsatz von Glanzlack werden Spiegelungen erzeugt, durch die Bilder aus dem Bereich der Betrachterrealität in die Objekte mit einbezogen sind. In das konkrete Bild wird so der Gegenstand integriert, das konkrete Bild und das abbildende Bild werden exemplifizierend zusammen-gebracht. Bedingt dadurch wird auch die farbige Situation der Objekte durch das Gegenüber beeinflusst.
In anderer Weise als bei früheren "Farb-Licht-Modulierungen" wird nun die Abhängigkeit der Objektrezeption vom Standort des Betrachters und der Betrachterbewegung formuliert.
Im Vergleich zu den zwischen 2002 und 2004 entstandenen Reliefs ist bei den jüngsten Objekten eine ungleich höhere Dynamisierung der Bildsituation festzustellen.
Die Einbeziehung der Spiegelung involviert ein gleichsam interaktives Verfahren, das den Betrachter als Gestaltungselement integriert. Die Rolle des aktiven Rezipienten, die bereits für vorangegangene Werkgruppen formuliert wurde, erfährt keine grundsätzliche Veränderung, sehr wohl aber eine qualitative.
War in den früheren Reliefs die Farbe am Objekt fest verortet und in den Schattenbildungen weitest gehend definiert, so gestaltet sich nun die Farb-Licht-Erscheinung in einer graduell höheren Abhängigkeit von der Bewegung vor dem Objekt. Entscheidenden Anteil daran hat wiederum die hochglänzende Fläche, die an den seitlichen Rundungen Glanzphänomene hervorbringt, die als vertikale weiße Lichtlinien analog der Bewegung des Betrachters vor dem Objekt, dessen Standortveränderung folgen und als variable Gestaltungselemente eine sich permanent ändernde Struktur am Objekt bewirken.
Hier wird u.a. deutlich, dass Sigurd Rompza in der Weise, wie er seine künstlerischen Anliegen durch die Mittel - Form, Farbe, Licht - zum Gegenstand macht, "Malerei mit außermalerischen Mitteln" (Rompza 2011, S. 64) betreibt, sodass seine Objekte auch als "Lichtinstrumente" (Rompza 2011, S. 36-40) gelesen werden können und dass das Kunstwerk im Sinne von Sigurd Rompza "ein speziell für sensuelle Erkenntnis hergestellter Gegenstand" ist. (Rompza 2011, S. 62)
Andreas Bayer
Biografie
-
1945geboren in Bildstock/Saar
-
Studium an der Pädagogischen Hochschule des Saarlandes
-
Studium der Malerei und Kunsttheorie bei Prof. Dr. Raimer Jochims, Städelschule Frankfurt/Main, Ernennung zum Meisterschüler
-
Mitglied der neuen gruppe saar
-
1972erste weiße Reliefs
-
seit 1985farbige Reliefs und Wandobjekte als offene Bildformen
-
seit 1973kunsttheoretische Texte, zahlreiche Veröffentlichungen zur Konkreten Kunst und zu den Grundlagen der Gestaltung
-
1981–1994Lehre an der Universität des Saarlandes/Fachrichtung Kunsterziehung
-
1994Professur an der HBKsaar für Grundlagen der Gestaltung
-
1999–2011Professur an der HBKsaar für Malerei und Grundlagen der Gestaltung
-
lebt und arbeitet in Neunkirchen/Saar
Einzelausstellungen
-
1976Buchhandlung der Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken
-
1977Atelier Glasmeier, Gelsenkirchen
-
1979Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
Studio Berggemeinde, Frankfurt
-
1982"Bei Victor Sanovec“, Maintal-Hochstadt
-
1983Galerie Circulus, Bonn
-
1984Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
Studio Berggemeinde, Frankfurt
-
1985Studio A, Otterndorf/Niederelbe
-
1986"Reliefs 1972–1986“, Galerie im Atelier Gundis und Heinz Friege, Remscheid
-
1990Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (K)
-
Saarland Museum, Saarbrücken (K)
-
Galerie De Sluis, Amsterdam/NL
-
1991Galerie Grewenig, Heidelberg-Handschuhsheim
-
Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler
-
1992Museum des Landkreises Cuxhaven Studio A, Otterndorf
-
März-Galerien, Ladenburg und Mannheim (K)
-
Galerie Große Bleiche, Mainz
-
1994Galerie Florence Arnaud et Maximilien Guiol, Paris/FR
-
1995"Sehstücke - Wandobjekte und Bilder“, KunstRaum Klaus Hinrichs, Trier
-
"Sehstücke - Wandobjekte und Reliefs“, Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
1996"Wandobjekte“, Galerie Große Bleiche, Mainz
-
"Farbige Wandobjekte“, Galerie Spielvogel, München
-
1997"Wandobjekte“, Galerie Suciu, Ettlingen
-
"Sculptures“, Galerie Florence Arnaud et Maximilien Guiol, Paris/FR
-
"Wandobjekte und Zeichnungen“, Galerie Grewenig, Heidelberg
-
1998"Zeichnungen und Wandobjekte“, Galerie its art ist, Waterloo/BE
-
"Neue Wandobjekte und Zeichnungen“, Galerie Krohn, Badenweiler
-
2000"Etwas zum Sehen machen“, Kunstverein Dillingen, Schloß Dillingen, (K)
-
Galerie Florence Arnaud et Maximilien Guiol, Paris/FR
-
2002"Wandobjekte“, März-Galerien, Ladenburg und Mannheim
-
École des Beaux-Arts, Rennes/FR
-
Galerie Bergner und Job, Wiesbaden
-
2003"Farbige Reliefs und Wandobjekte“, Galerie Spielvogel, München
-
2004"Etwas zum Sehen machen“, Kunstverein Speyer
-
2005"Sehstücke“, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn (K)
-
"Sehstücke“, Galerie St. Johann, Saarbrücken, (K)
-
2007"Neue Wandobjekte“, März-Galerien, Ladenburg; Galerie De Rijk, Den Haag/NL
-
2008"Sehstücke“, galerie konkret martin wörn, Sulzburg (K)
-
“Sigurd Rompza –Sehstücke – Wandobjekte“, märz galerie, Mannheim (K)
-
2009"Sehstücke“, Kunsthaus Rehau (K); "Sehstücke“, Galerie Lahumière, Paris/F (K)
-
2010"sigurd rompza – wandsculpturen“, Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"Sigurd Rompza – Sehstücke 1985-2010“, Beardsmore Gallery, London/GB
-
2011"Sehstücke 1977-2010“, Galerie der HBKsaar, Saarbrücken
-
2012"Sigurd Rompza“, Galerie Wilmsen, Hergartz
-
"Sehstücke“, Galerie Leonhard, Graz/AU
-
2014"Sehstücke", Galerie Contemporanea, Oberbillig
-
"sehstücke", Galerie La Ligne, Zürich
-
2015"Sigurd Rompza – Sehstücke Wandobjekte", Gudrun Spielvogel Galerie & Edition, München
-
2016"Sigurd Rompza – Sehstücke", Galerie Leonhard, Graz/AU
-
2017"Sigurd Rompza – Sehstücke", Galerie Ruhnke, Potsdam
-
2018"Sigurd Rompza – Sehstücke", Atelier-Editions Fanal, Basel/CH
-
2019"Sigurd Rompza – Sehstücke", Saarländische Galerie, Berlin
-
"Ist es, wie es uns erscheint?" (mit Jan Meyer-Rogge), Galerie Contemporanea, Oberbillig
-
2020"AnsichtSachen – Sigurd Rompza - Reliefs und Wandplastiken", Kunstraum Friesenstraße, Hannover (K)
-
2021„Sigurd Rompza – farb-licht-modulierung - Wandobjekte“, Kunstkabinett der Galerie Spielvogel, München
-
„recent works“ (mit Jean-Pierre Maury), Galerie Quadri, Brüssel/BE
-
2022"Sigurd Rompza – Eugen Gomringer. Jeux d'image - Jeux de language", Galerie St-Hilaire, Fribourg/CH
-
2023"Sigurd Rompza – Sehstücke 1983–2022", Schauraum am Laboratorium – Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Saarlouis (K)
-
"Sigurd Rompza – Sehstücke", Galerie Leonhard, Graz/AU
Ausstellungsbeteiligungen
-
1975neue gruppe saar, Simeonstift, Trier (K)
-
1976"schwarz und weiß" - Mappenwerk der neuen gruppe saar, Buchhandlung der Saarbrücker Zeitung, Saarbrücken
-
1977"Accrochage", Galerie im Zwinger, St. Wendel
-
"Elementarität und Reduktion", neue gruppe saar, Moderne Galerie, Saarbrücken
-
Abbaye des Prémontrés, Pont-á-Mousson/FR und Stadttheater Remscheid (K)
-
1978"Hommage à Leo Grewenig", neue gruppe saar, Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
197921. Jahresausstellung der Neuen Darmstädter Sezession, Mathildenhöhe, Darmstadt
-
1980"Weiße Bilder", neue gruppe saar, Saarländischer Rundfunk, Saarbrücken (K)
-
1981Gesellschaft für Bildende Kunst, Palais Walderdorff, Trier
-
"Relief konkret in Deutschland heute", Moderne Galerie Saarbrücken, Kunstverein Konstanz und Kunstverein Heidelberg (K)
-
1982"Kunstsituation Saar", Marl und Dillingen/Saar (K)
-
1983"Kopf und Bauch - Ratio und Emotion", 23. Jahresausstellung der Neuen Darmstädter Sezession, Mathildenhöhe Darmstadt, Secessionshaus Wien und Kunstpalast Düsseldorf (K)
-
"weiter", Funke, Kolod, Rompza, Sanovec, bei Ortrun Buhl, Frankfurt (Faltblatt); Städelschule, Frankfurt a.M.
-
"Kleine Bilder, Objekte, Plastiken", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
1984"Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza", Galerie Im Zwinger, St. Wendel (K)
-
"Small is beautiful", Zapiecek Galery, Warschau/PL
-
1985"Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza", Haus an der Redoute, Bonn-Bad Godesberg (K)
-
"Krieglstein, Rompza, Staudt, Tschentscher", Kunstverein, Pforzheim (K)
-
"Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza", Goethe-Institut, Nancy/FR (K)
-
1986"Krieglstein, Rompza, Staudt, Tschentscher", Galerie in der Hofstatt, Marburg (K)
-
"Funke, Kolod, Rompza, Sanovec", Museum Bochum (K)
-
"Enzweiler, Holweck, Rompza, Staudt", Kimberlin Exhibition Hall, Leicester/GB (K)
-
"Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza", Edition und Galerie Hoffmann, Friedberg (K)
-
"Art Basel", Galerie und Edition Hoffmann, Friedberg, Basel/CH
-
"Internationale konkrete Multiples", Galerie L‘Idée, Zoetermeer/NL (K)
-
"Von zwei Quadraten - Wilhelm Hack zum Gedächtnis", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (K)
-
"Multiples der Galerie St. Johann", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
1987"Eckpunkte", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Kunsthalle, Bonn (K)
-
"Kunst für amnesty international", Galerie des Collinicenter, Mannheim
-
"Art Basel", Galerie und Edition Hoffmann, Friedberg, Basel/CH
-
"Konstruktive Tendenzen", Galerie unterm Turm, Stuttgart (K)
-
Städtische Galerie Villingen-Schwenningen (K)
-
"Konstruktion, Kontemplation, Expression", Stiftung Trudelhaus, Baden/CH
-
"1000 cm3 Geometrische Miniaturen", Galerie De Sluis, Leidschendam/NL
-
"Kleine Bilder, Objekte, Plastiken", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
1988"Form und Farbe - Farbe und Form", Stadtgalerie Saarbrücken (K)
-
"Art Basel", Galerie und Edition Hoffmann, Friedberg, Basel/CH
-
"Art Basel", Galerie De Sluis, Leidschendam/NL, Basel/CH
-
"Null-Dimension", Galerie New Space, Fulda (K)
-
"studio a zu gast in der kunsthalle bremerhaven", Kunsthalle Bremerhaven
-
"Trias, die Magie des Dreiecks", Atelier Glasmeier, Gelsenkirchen und Atelier- und Galeriekollektiv, Wuppertal
-
1989"Eine neue Räumlichkeit? Ilgen, Kidner, Mosso, Rompza", Galerie De Sluis, Leidschendam/NL (K)
-
"null-dimension", Hipp-Halle, Gmunden/AU; Architekturmuseum, Wroclaw/PL (K)
-
"Zwischen Malerei und Objekt - Böhm, Glattfelder, Rompza, Staudt", Museum Schloß Philippsruhe Hanau (K)
-
"Sommerausstellung" Museum im Mia-Münster-Haus, St. Wendel (K)
-
"Spuikom-Modelle - 14 Modelle einer internationalen Auswahl bildender Künstler und Architekten", Galerie Belamy 19, Vlissingen/NL (K)
-
"Art Cologne", Galerie Hoffmann, Friedberg, Köln
-
1990"Heads & Legs", Sala Previa, Madrid/ES
-
"1000 cm3 Geometrische Miniaturen", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (K)
-
"Zeichen der Zeit", Galerie New Space, Fulda
-
"Carte blanche à 'Mésures'", Galerie Cogeime, Brüssel/BE
-
Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn
-
"1000 cm3 Geometrische Miniaturen", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (K)
-
"Zeichen der Zeit", Galerie New Space, Fulda
-
"Carte blanche à ‚Mésures‘“, Galerie Cogeime, Brüssel/BE
-
"Eine neue Räumlichkeit? Ilgen, Kidner, Mosso, Rompza", Galerie Schlégl, Zürich/CH (K)
-
"avantgarde '90 - universal progression", central exhibition hall/Manege, Moskau/RU
-
"Kleine Bilder, Objekte, Plastiken", Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
1991"Accrochage", März-Galerien, Ladenburg und Mannheim
-
"Künstler für Greenpeace", Atelier- und Galeriehaus Wuppertal
-
"Art Frankfurt", Galerie Hoffmann und Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler, FRankfurt
-
"About Perception", Galerie Moving Space, Gent/BE (K)
-
"Positionen konkreter Kunst - Enzweiler, Holweck, Rompza, Staudt", Manes Kunsthalle Prag/CZ (K)
-
"Hommage à Imre Kocsis", Repères au Château de Courtry, Melun/FR
-
"Art Basel", Galerie Hoffmann, Friedberg und Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler, Basel/CH
-
"Skulpturen, Objekte und Installationen", Museum im Mia-Münster-Haus, St. Wendel (K)
-
Galerie De Sluis, Amsterdam/NL
-
"entschieden und konsequent", Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler
-
"Europäische Dialoge", Museum Bochum (K)
-
"Redukta", Schloß, Warschau/PL (K)
-
"Landesgalerie des Saarland Museums", Saarbrücken (K)
-
"Kleine Bilder, Objekte, Plastiken", Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
"Accrochage", März-Galerien, Ladenburg und Mannheim
-
"Künstler für Greenpeace", Rathaus der Stadt Wuppertal
-
1992"vertikal, diagonal, horizontal", Tiroler Kunstpavillon, Innsbruck/AU
-
"Konstruktive Kunst in Europa ab den 20er Jahren", Galerie Emilia Suciu, Karlsruhe
-
"Repères", Stiftung für konkrete Kunst, Reutlingen (K)
-
"Kleine Bilder, Objekte, Plastiken", Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
1993"Aspects actuels de la Mouvance Construite internationale", Musée des Beaux-Arts Verviers/BE (K)
-
"Art Frankfurt", Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler
-
"Die Spirale", Atelier-Galerie Rolf Glasmeier, Gelsenkirchen
-
"Vier Künstler aus dem Landkreis Neunkirchen: Paul Antonius, Hans Huwer, Sigurd Rompza, Volker Scheiblich", Museum im Bürgerhaus Neunkirchen (K)
-
"Dix ans pour l‘art construit - repères au Château de Courtry", Melun/FR
-
"Zeitgenössische Skulpturen von Künstlern der Galerie Schégl (Albrecht, Ilgen, Rompza, Staub, Suter, Ullrich)", Zürich/CH
-
"Streifzüge durchs Depot - konstruktive und konkrete Kunst aus den Magazinen", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
-
"Art Basel", Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler und Galerie Hoffmann, Friedberg, Basel/CH
-
"Forum konkrete Kunst", Peterskirche, Erfurt
-
"Kleine Bilder, Objekte, Plastiken," Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
1994"Aspecten van de hedendaagse constructieve Beweging", Königliches Museum Antwerpen/BE (K)
-
"Ausstellung mit Skulpturen, Objekten, Installationen, Bildern und Büchern zum Thema ‚Punkt‘“, Atelier-Galerie Rolf Glasmeier, Gelsenkirchen
-
"Repères - compositions pour l‘Art Construit", Centre d‘Art Contemporain de Saint-Priest, Saint-Priest/FR (K)
-
"Hommage au carré - für Vera Molnar zum 70. - Bilder, Zeichnungen, Objekte", März-Galerien, Mannheim und Ladenburg
-
"Art Frankfurt", Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler, Frankfurt
-
"Drucke und Multiples", März-Galerien Ladenburg, Mannheim
-
"Aspects de la mouvance construite en Europe (John Carter, Fré Ilgen, Michel Jouet, Jean Pierre Maury, Sigurd Rompza)", Galerie its.art.ist, La Hulpe/BE
-
"vue du collectionneur", Espace de l‘art Concret - Château de Mouans, Mouans-Sartoux/FR (K)
-
1995"Kleine Bilder, Zeichnungen, Objekte, Plastiken - Accrochage der Galerie St. Johann 1994/95", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn (K)
-
"Standortbestimmungen", Galerie Museum im Bürgerhaus, Neunkirchen (K)
-
"Künstler der Galerie", Galerie Große Bleiche, Mainz
-
"Premier Salon International d‘Art Contemporain à Strasbourg", Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler
-
"Reliefs et Découpes", Galerie Lahumière, Paris/FR (K)
-
"Werkstatt Konkreter Kunst", Städtische Galerie Remscheid (K)
-
"Art Frankfurt", Galerie Große Bleiche, Mainz, Frankfurt
-
"Art Basel", Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweeilöer, Basel/CH
-
"Kunst '95", Internationale Kunstmesse Zürich, Galerie Dr. Luise Krohn, Badenweiler, Zürich/CH
-
"concrete reality and reflection", Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"Zeichen der Zeit", Forum Konkrete Kunst, Peterskirche, Erfurt
-
"Kleine Bilder, Zeichnungen, Objekte, Plastiken - Accrochage 1995/96", Galerie Grewenig, Heidelberg (K)
-
"L‘Art Concret aujourd‘hui", Espace de l‘art concret, Mouans-Sartoux/FR (K)
-
1996Art Strasbourg, Galerie Carlebach, Straßburg/FR
-
"Pink et Rouge", März-Galerien, Mannheim und Ladenburg
-
"Art Frankfurt", Galerie Große Bleiche, Frankfurt
-
"5 Jahre - Jubiläumsausstellung der Galerie Spielvogel", München
-
"vertikal, diagonal, horizontal", Kammerhofgalerie der Stadt Gmunden/AU (K)
-
Kunstmesse Zürich, Galerie Krohn, Badenweiler, Zürich/CH
-
"Art Cologne", Galerie Spielvogel, München, Köln
-
"concrete reality and reflection, part II", Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"Vertikal, diagonal, horizontal", Galerie des Hauses Dacheröden, Erfurt (K)
-
1997"Vertikal, diagonal, horizontal", Pulchri Studio, Den Haag/NL (K)
-
"Toiles à bandes", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Aspekte konkreter Kunst", März-Galerien Ladenburg, Mannheim
-
"Vertikal, diagonal, horizontal", Kunstverein Wiligrad, Galerie Schloß Wiligrad (K)
-
"Transparenz", Galerie Hoffmann, Friedberg
-
"Art Frankfurt", Galerie Große Bleiche, Frankfurt
-
"Art Basel", Galerie Dr. Luise Krohn und Editions Fanal, Basel/CH
-
"Im Bewußtsein der Zusammenhänge - das Museum Bochum 1972-1997", Museum Bochum
-
"Atelier - Editions Fanal", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
"Donation Repères art construit - art concret", Mâcon/FR (K)
-
1998"Objekte", März-Galerien Ladenburg, Mannheim
-
"Art Frankfurt", Galerie Job, Frankfurt
-
"Art Basel", Editions Fanal, Basel/CH
-
"Fanal - Konstruktive Kunst konkrete Kunst - 30 Jahre Atelier - 20 Jahre Edition", Musée Tavet-Delacour, Pontoise/FR und Richard-Haizmann Museum, Niebüll (K)
-
"Fanal - Rétrospective des oeuvres d‘artistes et du travail d‘atelier", Basel/CH (K)
-
Kunstmesse Zürich, Galerie Spielvogel, München, Zürich/CH
-
"Reflections", Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
1999"Ryszard Winiarski gewidmet", Art Consulting Galeria, Warschau/PL
-
"Art Frankfurt", Galerie Spielvogel, München, Frankfurt
-
"Art Basel", Atelier-Editions Fanal, Basel/CH
-
"Art Basel", Galerie Schlégl, Zürich/CH, Basel/CH
-
"La nature imite l‘art", Espace de l‘art concret, Château de Mouans, Mouans- Sartoux/F
-
"Farbschatten", März-Galerien Ladenburg, Mannheim
-
"30 Jahre Galerie St. Johann - 30 x 30 x 30 cm", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
"Art Cologne", Galerie Hoffmann, Friedberg, Köln
-
"Constructive Art in Europe at the Threshold of the 3rd Millennium", Galerie Emilia Suciu, Ettlingen und Galerie Hors Lieux, Strasbourg/FR
-
2000"Art Frankfurt", Galerie Job, Frankfurt
-
"Art Basel", Atelier-Editions Fanal, Basel/CH
-
"Farbe Weiß", Kunstverein Wiligrad, Schloß Wiligrad, Lübstorf (K)
-
"In memoriam Max H. Mahlmann", Galerie Hoffmann, Friedberg
-
"Das entgrenzte Bild", Gmunden/AU (K)
-
"Essentials", Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"Ligne(s) de conduite, Espace de l’Art Concret, Château de Mouans-Sartoux/FR
-
"Art Cologne", Galerie Hoffmann, Friedberg, Köln
-
"Experiment Farbe", Galerie Hoffmann, Friedberg
-
2001"Ausstellung zeitgenössischer saarländischer Kunst", Landeszentralbank, Mainz
-
"Art Frankfurt", Galerie Spielvogel und März-Galerien
-
"Veränderung - Neuerwerbungen der vergangenen zehn Jahre", Studio A, Otterndorf
-
"Das entgrenzte Bild", Städtische Kunstsammlungen Schloß Salder, Salzgitter (K)
-
"Art Basel", Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Schlégl, Zürich/CH, Basel/CH
-
"Dialog von Fläche und Raum", Kunstverein Wiligrad
-
"Das entgrenzte Bild", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn
-
"Für Vera Molnar", Museum Grenoble/FR
-
"Aus den Beständen der Galerie", Galerie Bergner und Job, Mainz
-
2002"Art Frankfurt", Galerie Bergner und Job und März-Galerien Ladenburg, Frankfurt
-
"Art Basel", Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Krohn, Badenweiler, Basel/CH
-
"Künstler am Beginn des 21. Jahrhunderts - Zeichnung", Künstlerhaus Metternich, Koblenz
-
"Das entgrenzte Bild", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (K)
-
Ausstellung anlässlich des Symposions "Stein des Anstoßes - Symposion zu Fragen der Kunst im öffentlichen Raum", Saarland Museum, Saarbrücken
-
"Accrochage zum 20sten", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn
-
"Dopo il bianco", Galerie Vismara, Mailand/IT
-
2003"Art Frankfurt", Galerie Bergner und Job und März-Galerien Ladenburg, Frankfurt
-
"Künstlerwidmungen an Christa Lichtenstern", Galerie Marlies Hanstein, Saarbrücken (K)
-
"Art Basel", Editions Fanal, Basel/CH
-
"concrete reality and reflection part III", Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"Sommerfest (das letzte)", Galerie Krohn, Badenweiler
-
"Präsentation zum Saarlandtag" des Instituts für aktuelle Kunst in Saarlouis, Mia-Münster-Haus, St. Wendel
-
"neue gruppe saar", Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis (K)
-
"Ben Muthofer und Sigurd Rompza", Galerie Suciu, Ettlingen
-
"Multiple Grafik und Objekte", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
2004"Wandobjekte und Zeichnungen", Galerie Bergner und Job, Mainz
-
"La revue Mesures (1988-1995), Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis/FR
-
"ein-sehen", Galerie Hoffmann, Ausstellungshalle Ossenheim
-
"50 quadrat" - ein aktueller Überblick über die internationale konkrete Kunst", galerie und edition konkret martin wörn, Sulzburg (K)
-
"Art Frankfurt", Galerie Bergner und Job (Einzelpräsentation) und März-Galerien, Frankfurt
-
"Art Basel", Atelier Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Schlégl, Zürich/CH, Basel/CH
-
"Hommage à Vera Molnar", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
-
Sparda-Bank-Kunst-Raum, Saarbrücken (K)
-
Donation Albers - Honegger, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux/FR (K)
-
"Into the room - Objekte und Reliefs von Hans Jörg Glattfelder, Bernhard Haertter, Russel Maltz, Brigitte Stahl, Sigurd Rompza und Dorothée Schellhorn, Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"50 quadrat + kompakt konstruktiv konkret", Kammerhof Galerie, Gmunden/AU
-
Szöllösi-Nagy - Nemes Collection, Müvészet Malom (Art Mill), Szentendre/HU (K / CD)
-
"Fabriqué en Sarre - Mappenwerk mit Druckgrafiken von Studierenden der Hochschule der Bildenden Künste Saar aus dem Atelier von Prof. Sigurd Rompza und von Gästen", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
"Editionen und kleine Formate", Galerie Bergner und Job, Mainz
-
2005"Gelb und Gold", März-Galerien Ladenburg, Mannheim
-
"Art Frankfurt", März-Galerien Ladenburg, Frankfurt
-
"50 Quadrat, un regard actuel sur l’art concret international", Musées de Sens/FR
-
"Art Basel", Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Schlégl, Zürich/CH, Basel/CH
-
"Konkrete Kunst aus Europa - Vertikal in Fläche und Raum", Kunstverein Wiligrad, Schloß Wiligrad
-
"Utopie réalisée - Un bienvenu à l’Espace de l’Art Concret de Mouans-Sartoux", haus konstruktiv, Zürich/CH
-
"50 quadrat - An actual view on the international concrete Art", Benoot Gallery, Knokke-Zoute/BE
-
"FIAC Paris", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"art construit - art concret, donation Eva-Maria Fruhtrunk, Musée de Cambrai/FR (K)
-
"Kleinformate von 52 europäischen Künstlern", Galerie Suciu, Ettlingen
-
"Multiple Objekte", Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
2006"weiss", März Galerien; "50 quadrat", Mondriaanhaus, Amersfoort /NL (K)
-
"Art Karlsruhe", März-Galerien Ladenburg, Mannheim
-
"Art Basel", Galerie und Editons Fanal, Basel/CH, Galerie Lahumière, Paris/FR, Galerie Schlégl, Zürich/CH, Basel/CH
-
"Mais de quoi se mêlent-ils?", Bibliotheca Wittockiana, Brüssel/BE; Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis/FR (K)
-
"Leben mit Kunst - Die Sammlung Kaldewey", Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis (K)
-
Werkstatt-Galerie Friege, Galerie der Stadt Remscheid (K)
-
"Peinture - objets", Galerie und Editions Fanal, Basel/CH
-
"FIAC Paris", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"ART Cologne", Galerie Hoffmann, Friedberg und Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"35", Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"Wunderkammer" Jahresausstellung 2006, Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
"Autour du Blanc", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Neue Künstler, neue Werke...", Galerie Suciu, Ettlingen
-
2007"10 jaar Galerie - Kunsthandel de Rijk", Galerie De Rijk, Den Haag/NL (K)
-
"Art Rotterdam", Galerie De Rijk, Den Haag/NL
-
"Art Amsterdam", Galerie De Rijk, Den Haag/NL
-
"Art Karlsruhe", März-Galerien, Ladenburg und Galerie Suciu, Ettlingen, Karsruhe
-
Editions Fanal zu Gast in der Galerie Schlégl, Zürich/CH
-
"Art Paris", Galerie Lahumière, Paris/FR und Galerie Suciu, Ettlingen, Paris/FR
-
"Exemplifizieren wird Kunst", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (K)
-
"8 x konkret", Beardsmore Gallery, London/UK (K)
-
"Painting Painting", Museum Sammlung Vass, Veszprem/HU (K)
-
"White and Black", Vasarely Museum, Budapest/HU
-
"Art Basel", Galerie und Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/FR, Basel/CH
-
"Sommerausstellung", Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"Un parcours II", Galerie Lahumière/Paris und La Grande Motte/FR (K)
-
"Tryptique - Manifestation d’art contemporain", Angers/FR
-
"Reliefs und Wandobjekte", Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"Exemplifizieren wird Kunst", Vasarely Museum, Budapest/HU (K)
-
"PAN Amsterdam", Galerie De Rijk, Den Haag/NL (K)
-
"das kleine format - petit format - small format", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"Frisch gestrichen - Peinture fraîche", Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
2008"London art fair", Beardsmore Gallery, London/GB; "gestern war .... heute ist", Museum gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf (K)
-
"Art Paris", Grand Palais, Galerie und Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Art Amsterdam", Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"color! - die farbe in der konkreten kunst", galerie konkret martin wörn Sulzburg (K)
-
"Art Basel", Galerie und Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/FR, Basel/CH
-
"Visites d’Atelier", Galerie Op der Kap, Capellen/LU (K)
-
“Saarbrücker Kunst im Wandel der Zeit - Der Weg der Region in eine künstlerische Identität", Sparkasse Saarbrücken
-
"Dein Land macht Kunst", Landeskunstausstellung, Saarlandmuseum, Saarbrücken (K)
-
"Exemplifizieren wird Kunst", Museum Ludwig, Koblenz (K)
-
"das kleine format - petit format - small format", Kunsthaus Rehau (K)
-
"klein maar fijn", Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"Gegenstandslos", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn
-
"Petersburg..." Jahresausstellung 2008, Galerie St. Johann, Saarbrücken (K)
-
"20 Jahre - 20 ans - 20 years", Galerie Emilia Suciu, Ettlingen
-
"Atelier-Editions Fanal", Paksi Képtár, Paks/HU
-
2009Accrochage, Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"Art Karlsruhe", Galerie Bergner und Job, Mainz und März Galerie Blanka Heinecke, Mannheim, Karsruhe
-
"Bibliotheca Durantiana: Reliures d’artistes modernes & contemporains", Bibliotheca Wittockiana, Brüssel/BE (K)
-
"Art Paris", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
Accrochage, Galerie Emilia Suciu, Ettlingen
-
"alles", Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Art Basel", Galerie Lahumière, Paris/FR und Editions Fanal, Basel/CH
-
"regard 06: Quand la géométrie devient Art", Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux/FR
-
"zwart wit", Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
L’oblique - un regard sur la géométrie contemporaine", Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard/FR (K)
-
"Positionen Konkreter Kunst heute", Landesmuseum, Mainz (K)
-
"L’abstraction géométrique d’aujourd’hui", Gallery Moteki, Tomioka/Japan und Gallery Chikyu-dou,Tokyo/JP
-
"mehrfach - kunst in kleinen auflagen", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"reconnaître", Paksi Keptar/HU (K)
-
"geometrisch-abstrakt-kinetisch", Galerie Suciu, Ettlingen
-
"1/1.....1/100 - Editionen aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn
-
"Tijdgenoten", Galerie De Vierde Dimensie, Plasmolen/NL
-
2010"London art fair", Beardsmore Gallery, London/UK
-
"Positionen konkreter Kunst heute", Galerie Grewenig, Heidelberg (K)
-
"Galerie Emilia Suciu - geometrisch - abstrakt - kinetisch", Kunstverein Speyer
-
"Art Karlsruhe", März Galerie Blanka Heinecke, Mannheim
-
"Couleur et Géométrie", Musées de Sens, Sens/FR (K)
-
"Skulpturen, Wandobjekte, Bodenarbeiten Plastiken - 20 Jahre Institut für aktuelle Kunst im Saarland", Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Saarlouis
-
"Panorama graphique et petite sculpture construite", Galerie Le Cube, Estavayer-le-Lac/CH
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Art Amsterdam", Galerie De Rijk, Den Haag /NL
-
"Art Basel", Galerie und Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/F, Basel/CH
-
"Zehn Jahre Kunsthaus Rehau", Rehau
-
"one-week-show", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"Selbst machen. Was produzieren eigentlich die Professoren?" Galerie der HBKsaar, Saarbrücken
-
"Couleur et Géométrie", Kunstverein "Talstrasse", Halle/Saale (K)
-
"Sommerausstellung", Galerie Emilia Suciu, Ettlingen
-
"Kabinettausstellung im Kunstverein Freiburg: edition konkret martin wörn", Freiburg
-
“Konkrete Konzepte", Galerie Ruhnke, Potsdam
-
"Point, Line in Movement", Museum Vasarely, Budapest/HU (K)
-
"Couleur et Géométrie", Kunsthaus, Nürnberg (K)
-
"RotBlauGelb", März Galerie, Mannheim
-
"art concret, géométrique, abstrait, construit", Galerie Jean Greset, Besançon/FR
-
"Winter", Galerie Schlégl, Zürich /CH
-
"Konkrete Konzepte", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
2011"Farbe und Geometrie - Konkrete Kunst der Gegenwart in Europa", National Museum, Kielce/PL (K)
-
"London art fair", Beardsmore Gallery, London/UK
-
"Face à face - sculptures et reliefs", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Art Karlsruhe", März Galerie Blanka Heinecke, Mannheim und Galerie Emilia Suciu, Ettlingen
-
"Art Paris", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Formes et lumière: La sculpture dans l’art construit", Musée de Cambrai/FR (K)
-
"Art Basel", Atelier-Editions Fanal, Basel/CH
-
"blau", galerie konkret martin wörn, Sulzburg (K/ CD)
-
"Couleur et géométrie - Actualité de l’art construit européen", Centre d’art contemporain Frank Popper, Marcigny/FR (K)
-
"Formes et lumière: la sculpture dans l’art construit", Musée Pierre-André Benoît, Alés/FR
-
"überblick - oberrhein galerien", galerie konkret martin wörn, Kunstverein March
-
"minimal - kleine formate", März Galerie Blanka Heinecke, Mannheim
-
"metall konkret", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
2012"London art fair", Beardsmore Gallery, London/UK
-
Karen Irmer - Fotografie / Sigurd Rompza - Wandobjekte, Ecke Galerie, Augsburg
-
"Das Metall in der konkreten Kunst", Galerie Emilia Suciu, Ettlingen
-
"Art Karlsruhe", März Galerie, Mannheim
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Metall Konkret", Galerie Grewenig/Nissen, Heidelberg
-
"Panorama 2", Galerie Le Cube, Estavayer-le-Lac/CH
-
"konkret und konstruktiv - kunst in deutschland", Kunstverein Wiligrad, Schloß Wiligrad
-
"spring is in the air!", Galerie de Rijk, Den Haag/NL
-
"Konstruktivismus - Op Art - Kinetik", Galerie Leonhard, Graz/AU
-
"Metall - Konkret - Remix / Plastiken und Objekte", Deutsche Werkstätten Hellerau, Dresden
-
"Art Basel", Galerie Lahumière, Paris/FR, Galerie und Editions Fanal, Basel/CH
-
"rot", galerie konkret martin wörn, Sulzburg; art bodensee Dornbirn/AU, Galerie Wilmsen, Hergartz
-
Jean-François Dubreuil, Hans Glattfelder Sigurd Rompza Torsten Ridell, Galerie Jean Greset, Besançon/FR
-
"Positionen konkreter Kunst heute", Stadtmuseum Simeonstift, Trier
-
"Farbräume", März Galerie Blanka Heinecke, Mannheim
-
"Herbst.Zeit.Lose", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn
-
"Art Fair Köln", Galerie Wilmsen, Köln
-
"same same - but different", Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Bonn
-
"Konkret: Das kleine Format", Galerie St. Johann, Saarbrücken
-
2013"Art Karlsruhe", Galerie Wilmsen, März Galerie - Blanka Heinecke, Galerie Lahumière, Galerie Suciu, Karlsruhe
-
“transparenz“, galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"SaarART 2013", Landeskunstausstellung, Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken e.V., Saarbrücken
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Art Basel", Galerie und Editions Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/FR, Basel/CH
-
"surprise, surprise", Galerie Jean Greset, Besançon/FR
-
"raumgreifend. wandobjekte", Gisela Hoffmann, Jean Mauboulès, Gert Riel, Sigurd Rompza, Stephan Wolter, März Galerie - Blanka Heinecke, Mannheim
-
"Wieder Sehen", Museum gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf
-
"Viennafair", Galerie Leonhard, Graz/AU, Wien/AU
-
"Cinquante ans", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Sympathy for the devil", Galerie Jean Greset, Besancon/FR
-
2014"Sigurd Rompza – Gottfried Honegger", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"RAW Artfair Rotterdam", Galerie de Rijk, Leeuwarden/NL, Rotterdam/NL
-
"Word and Image", Vasarely Museum of Fine Arts, Budapest|/HU (K)
-
"Art Paris", Galerie La Ligne, Zürich/CH, Paris/FR
-
"Art Karlsruhe", März-Galerie, Mannheim und Galerie Lahumière, Paris/FR, Karlsruhe
-
"Frank Badur – Die Sammlung im Dialog", Moderne Galerie des Saarlandmuseums, Saarbrücken
-
"Architectures du Silence – Carte Blanche à Chistophe Duvivier", Galerie Gimpel und Müller, Paris/FR
-
"Art Basel", Galerie Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/FR, Basel/CH
-
Accrochage, galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"Aspekt Raum", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"Die Linie", Galerie Grewenig/Nissen, Heidelberg-Handschuhsheim
-
"Art Fair Köln", Galerie Wilmsen, Hergartz, Köln
-
"Art & Antique", Galerie Leonhard, Graz/AU, Hofburg Wien, Wien/AU
-
"Affordable Art Fair Hamburg", Galerie Wilmsen, Hergartz, Hamburg
-
"ballet concrete", zs art galerie, Wien/AU
-
2015"London Art Fair", Galerie Beardsmore, London/UK
-
"Art Paris", Galerie La Ligne, Zürich/CH, Paris/FR
-
"Art Karlsruhe", März Galerie - Blanka Heinecke, Galerie Leonhard, Galerie AIC, Galerie Jean Greset, Karlsruhe
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Ein Blick zurück nach vorn", Galerie Contemporanea, Oberbillig
-
Accrochage, Galerie De Rijk, Den Haag/NL
-
"Rendezvous der Länder – Sammlung Peter C. Ruppert. Konkrete Kunst in Europa nach 1945", Museum im Kulturspeicher, Würzburg
-
"Art Basel", Galerie Fanal, Basel/CH und Galerie Lahumière, Paris/FR, Basel/CH
-
"Die Sammlung Klütsch", Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis
-
"Viennafair", Galerie Leonhard, Graz/AU, Wien/AU
-
"A fine selection of Editions – Multiples – Books", Galerie La Ligne, Zürich/CH
-
"kleinplastik - relief - objekt", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
“Künstler der Galerie“, Galerie Leonhard, Graz/AU
-
Kunstmesse Bergamo, Galerie Leonhard, Graz/AU
-
2016"Vision dynamique", Galerie und Edition Fanal, Basel/CH
-
"25 Jahre Art Studio Deinste", Deinste
-
"Art Karlsruhe", Galerie Leonhard Graz/AU, Galerie Wilmsen, Rheineck/CH, Galerie Zèro l’infini, Besancon/FR, Karsruhe
-
"Drucksachen", Haus der Ärzte, Saarbrücken
-
"30 x 30 x 30 - internationale Gruppenausstellung", zs art galerie, Wien/AU
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Art Basel", Galerie und Edition Fanal, Basel/CH
-
"Schweben - Zwischen Illusion und Wirklichkeit, Transzendenz und Transparenz", Luftmuseum Amberg
-
Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum der Galerie Spielvogel, München
-
"Modus Operandi", Reliures d’artistes modernes & contemporains, Bibliotheca Wittockiana, Woluwe-Ste-Pierre/BE (K)
-
"Glattfelder, Rompza, Pasquer", Galerie la Vitrine, Fribourg/CH
-
"Art Fair", zs art galerie, Wien/AU, Köln
-
"minimum - kleinformatige konkrete kunst", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
Sigurd Rompza, Hans Jörg Glattfelder und Vera Molnar, März Galerie, Mannheim
-
"Luxembourg Art Week", Galerie medi Art, Luxemburg/LU
-
2017"Radical", Galerie Quadri - Ben Durant, Brüssel/BE
-
"Abstrakte und konkrete Kunst aus 66 Jahren Galerie", Galerie Grewenig-Nissen, Heidelberg-Handschuhsheim
-
"Art Karlsruhe", Galerie Leonhard, Graz/AU, Galerie Jean Greset, Besancon/FR, Karlslruhe
-
"5/5 5 artistes, 5 ans de la Galerie - Dubreuil, Glattfelder, Pasquer, Rompza, Sapin", Galerie la Vitrine, Fribourg/CH
-
"Saarart11", Landeskunstausstellung, Lehrwerkstatt Burbach, Saarbrücken (K)
-
"Art Basel", Galerie und Edition Fanal, Basel/CH
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Vom Bild zum Objekt", Galerie Panarte, Wien/AU
-
"Abstraction et Monochrome", Galerie Jean Greset, Etuz/FR
-
"à la carte - jean francois dubreuil, sigurd rompza, john carter", Galerie La Vitrine, Fribourg/CH
-
"L’art - sens de la vie", Donation Renate Trettin, Centre d’Art Contemporain Fank Popper, Marcigny/FR (K)
-
"Carlos Cruz-Diez & la Donation Albers-Honegger - Dialogues concrets", Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux/FR
-
"D’amours et d’art", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Luxembourg Art Week", Galerie medi Art, Luxemburg/LU
-
"Nemes Collection", Mank, Szentendre/HU
-
"Wieder sehen", Saarlandmuseum, Saarbrücken
-
2018"Art Karlsruhe", Galerie Leonhard, Graz/AU, Karsruhe
-
„Nicholas Bodde, Hans Jörg Glattfelder, Gottfried Honegger, Sigurd Rompza - approches de la couleur“, Galerie Lahumiere, Paris/FR
-
"Der erste Blick Zeichnungen Bilder Fotografien Skulpturen", sperling liefmann behn – kunstraum friesenstrasse, Hannover
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Art Basel", Galerie und Edition Fanal, Basel/CH
-
"Das Werk als Raum im Raum", zs art Galerie, Wien/AU
-
"summerspecial", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"résumé 2008–2018", märz galerie mannheim, Mannheim
-
"Petersburg Konkret", Galerie Spielvogel, München
-
"finale", galerie konkret martin wörn, Sulzburg
-
"PAN Amsterdam", Galerie De Rijk, Den Haag/NL
-
"Luxembourg Art Week", Galerie medi Art, Luxemburg/LU
-
2019"Jean Gorin", Galerie und Edition Fanal, Basel/CH
-
"Matinée Konstruktiv", Galerie Leonhard, Graz/AU
-
"Leo Grewenig und die neue gruppe saar", Museum der Stadt Bensheim (K)
-
"Konkrete Kunst - Atelier Editions Fanal Basel", Kunstverein Marburg
-
"Negativer Raum", ZKM, Karlsruhe (K)
-
"Art Cologne", Galerie Lahumière, Paris/FR, Köln
-
"Konstruktive Bilder und Malerei", Galerie Leonhard, Graz/AU
-
"Summer group exhibition", Galerie de Rik/Chabot, Den Haag/NL
-
"Der erste Blick", Kunstraum Friesenstraße, Hannover
-
"Wegweisungen für gezieltes Umherirren - Zur ersten Ausstellung der Hegenbarth Sammlung Berlin", Berlin
-
"Elementar - Jan Meyer-Rogge, Claudia Vogel, Sigurd Rompza", Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse, Speyer
-
"Konkret in Variation", Galerie Grewenig, Heidelberg-Handschuhsheim
-
"ART The Hague", Galerie De Rijk/Chabot, Den Haag/NL
-
"Rot ist schön", Galerie Spielvogel, München
-
"PAN Amsterdam", Galerie De Rijk/Chabot, Den Haag / NL
-
2020"Art Karlsruhe", Galerie Leonhard, Graz/AT
-
"Querbeet", Galerie Contemporanea, Oberbillig
-
"Windowshopping", Galerie Chabot Fine Art, Den Haag/NL
-
"Nouvelles donnes. La collection Albers-Honegger", Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux/FR
-
"Von der Malerei zur Geometrie", Galerie Leonhard, Graz/AT
-
"Biennale Internationale 'Petit Format de Papier et les Petits Formats Numériques'", MPFAC / CCAction Sud, Nismes/BE; Espace Beau Site - Arlon/B, WARP, Sint-Niklaas/BE (2021); LeGrand Curtius, Liège/BE (K)
-
Sammlung Suciu, Abigail Galeria, Budapest/HU (K)
-
2021Online-Ausstellung, Galerie Spielvogel, München
-
"Wer weiß? Eine Accrochage mit Werken von Künstlern der Galerie Spielvogel", München
-
PAN Amsterdam, mit Galerie Chabot Fine Art, Den Haag/NL
-
"Géométries croisées", Galerie Lahumière, Paris/FR
-
"Praeludium", Vaszary Gal ria, Balatonfüred/HU
-
"30 Jahre - Ein Jubiläum - Rückblick auf 30 Jahre Galerietätigkeit", Galerie Spielvogel, München
-
"le petit format dans tous ses états", Galerie Gimpel und Müller, Paris/FR
-
2022"konkret heute - 'Saarbrücker Schule'. Arvid Boecker, Jo Enzweiler, Esther Hagenmaier, Dirk Rausch, Sigurd Rompza, Claudia Vogel", Galerie Grewenig, Heidelberg-Handschuhsheim
-
"Die Vergangenheit der Zukunft - Konkrete und kinetische Kunst aus den Sammlungen Suciu undSzöllösi-Nagy-Nemes", Museum Ettlingen
-
London Art Fair, mit Beardsmore Gallery, London/UK
-
"Transparence Volume", Espace Fanal, Basel/CH
-
"Quadri a 35 ans", Galerie Quadri, Brüssel/BE
-
edition 1 – an exhibition of concrete and conceptual art editions, mit edition konkret (Staufen), St. Louis/FR
-
2023"Présence de la ligne", Espace Fanal, Basel/CH
-
Art Cologne, mit Galerie Lahumière (Paris/FR), Köln
-
"Gefährten", Museum gegenstandsfreier Kunst, Otterndorf
-
Art Austria, mit Galerie Leonhard (Graz/AT), Wien/AT
-
"Positionen nichtabbildender Kunst – Esther Hagenmaier, Dirk Rausch, Sigurd Rompza, Claudia Vogel", Kunstverein Dillingen, Dillingen/Saar
-
"Home@Museum. Eine Privatsammlung wohnlich ausgestellt", Kunstmuseum, Reutlingen (K)
-
Szöllősi-Nagy-Nemes Collection, Modern Műtár (MOMÜ), Balatonfüred/HU
-
"Konkrete Kunst – Von Alditüte bis ZERO", Pfalzgalerie, Kaiserlautern (K)
-
London Art Fair, mit Beardsmore Gallery, London/UK
-
2024Ausstellung anlässlich der Eröffnung der neuen Galerieräume, Galerie Lahumière, Paris/FR
Werke in Sammlungen
- Allianz Versicherung/Kunst in den Treptowers, Berlin
- Deutsche Bundesbank (ehemals Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland)
- Espace de l’Art Concret, Donation Albers/Honegger, Mouans-Sartoux/F
- Forum Konkrete Kunst, Erfurt
- Kultusministerium Saarbrücken
- Landesmuseum Mainz
- Messmer Foundation, Riegel
- Museum Bochum
- Musée de Cambrai, F, Donation Eva Maria Fruhtrunk
- Museum Chôlet/F
- Musée de Grenoble/F
- Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt
- Museum Lodz/PL
- Musée de Neuchâtel/CH, Sammlung Jeunet
- Musée des Ursulins, Sammlung Repères, Mâcon/F
- Saarland Museum, Saarbrücken
- Sammlung Gomringer, Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie, Rehau
- Sammlung Ruppert, Museum im Kornspeicher, Würzburg
- Sparda-Bank-Kunst-Raum, Saarbrücken
- Studio A, Museum des Landkreises Cuxhaven
- Vasarely Museum/open structure art society, Budapest/HU
- Volksbank Heidelberg
- Volksbank Neunkirchen
- Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
Werke im öffentlichen Raum
- Neunkirchen/Saar, Maximilian-Kolbe-Schule, Gestaltung einer Faltwand, 1980, Lack auf Holz
- Dillingen, Saar-Fern-Wärme-AG, Gestaltung des Wärmespeichers, 1986, Lack auf Aluminium, ca. 60 m hoch
- Saarbrücken, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Goebenstraße, Mobile Hängeplastik, 1988, Rundrohre aus Aluminium, Höhe ca. 8
- Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, Elektrotechnik, Verspannung, 1989, Seile, 305 cm, Durchmesser 5 cm, 4 x 4 m Raummaß
- Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Im Stadtwald, Elektrotechnik, Wandrelief, 1989, Aluminium weiß lackiert, 2,70 x 7,30 x 0,25 m
- Saarbrücken, Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken (ehemals Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland), Orange Spirale, 1998, Stahlrohr, pulverbeschichtet, Durchmesser 6 m, Durchmesser des Stahlrohrs 12 cm
- Friedrichsthal, Marktplatz, Brunnen, 2008, Edelstahl, 4 x 1,50 x 1,50 m
Bibliografie: Eigene Schriften
- Anmerkungen zum Umgang mit dem Material in der Ausstellung Papier als künstlerisches Medium. In: Katalog zur Ausstellung. Hg. Dietfried Gerhardus. Saarbrücken 1980, S. 39
- Arbeitsnotizen. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza, Ed Sommer, Klaus Staudt (Hg.): Relief konkret in Deutschland heute. Saarbrücken 1981, S. 129
- Arbeitsnotizen. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza, Ed Sommer, Klaus Staudt (Hg.): Relief konkret in Deutschland heute. Galerie St. Johann. Saarbrücken 1981, S. 129
- Bildentwicklungen aus der Quadratfläche; Zu den Stegreliefs (1. Fassung 1982). In: Circular. Zeitschrift für Kunst und Gestaltung. Heft 35/36, Bonn 1983, S. 3-5, 6-9
- Zur Konzeption der Steg- und Klappreliefs: In: Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza, Hg. Galerie St. Johann, Saarbrücken, 1984, o.S.
- Zur Konzeption der Stegreileifs. In: Matthias Bleyl, Christina Weiß (Hg.): Krieglstein, Rompza, Staudt, Tschentscher. Kunstverein Pforzheim. Pforzheim 1985, o. S.
- Antworten auf Fragen von Dietfried Gerhardus. In: Enzweiler, Holweck, Rompza, Staudt, Hg. Gerhardus Dietfried, Saarbrücken 1986, 35-41
- Text zur eigenen künstlerischen Arbeit. In: Eckpunkte – Positionen konkret- konstruktiver Kunst heute. Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V., Bonn 1987, S. 39-41
- Systematisch arbeiten. In: PRO – PRO ART AND ARCHITECTURE. Heft Nr. 2, Dordrecht/Holland 1987, S. 8-14
- Annäherung an die null-dimension. In: Pro – PRO ART AND ARCHITECTURE. Dordrecht/Holland 1989, Heft Nr. 5, S. 78 f.
- An offenen Bildformen ...; Grundsätzliche Überlegungen zur Konkreten Kunst. In: Die Explosion des Schwarzen Quadrats – Realität und Utopie in der rationalen Kunst. Hg. von der Gesellschaft für Kunst und Gestaltung e.V. Bonn 1990, S. 13-14, 84-85
- Zur künstlerischen Arbeit von Vera Molnar. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Schriftenreihe Beiträge zur aktuellen Kunst. Galerie St. Johann. Saarbrücken 1990, o. S.
- Anastasis – ein Bild von Raimer Jochims. In: Bulletin der Galerie St. Johann. Saarbrücken 1991. Heft 2, S. 4-5
- Zum Prinzip des Zufalls in konstruktiv-konkreter Kunst. In: Bernhard Holeczek, Lida von Mengden (Hg.): Zufall als Prinzip – Spielwelt, Methode und System in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog Wilhelm-Hack-Museum. Ludwigshafen 1992, S. 45-52
- Auf dem Prüfstand die Bildsprache – Konzeptionelle Überlegungen zu einer konstruktiv-konkreten Kunst heute – Angestellt im Hinblick auf eigene künstlerische Arbeiten. In: PRO Nr. 8. Febr. 1992. Dordrecht/ NL, S. 7-8
- Ein Beispiel für projektorientiertes Arbeiten in einer neuen bildlichen Gestaltungslehre: Die Copygrafie als gestalterisches Verfahren – Darstellung von Bewegung. In: Dietfried Gerhardus, Cornelieke Lagerwaard, Sigurd Rompza (Hg.): Bewegung – Versuche mit dem Kopiergerät als Beispiel für Grundlegungsprobleme bildlicher Gestaltung. Museum St. Wendel. St. Wendel 1992, S. 8-13
- Klaus Staudt, Konstante z 5/90. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Schriftenreihe Beiträge zur aktuellen Kunst. Galerie St. Johann. Saarbrücken 1992, S. 12-13
- Joost Baljeu, Leonardo Mosso, Klaus Staudt – Drei künstlerische Konzepte ein Vergleich. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Bulletin der Galerie St. Johann. Saarbrücken 1993, Ausgabe 4, S. 7-12
- Herstellen und darstellen – Zu Wolfgang Nestlers Plastik Federstahlkubus. Schriftenreihe der Stadtgalerie Saarbrücken und des Deutschen Werkbundes Saar. Heft 7, Saarbrücken 1993
- Interview de Vera et de François Molnar par Sigurd Rompza. Paris 1992. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Zeitschrift für Kunst, Architektur und Gestaltung. Heft 1, Saarbrücken 1995, S. 23-27
- Wie unterscheiden sich in darstellender Hinsicht eine Zeichnung von Morandi und ein Sessel von Le Corbusier? In: Dietfried Gerhardus, Sigurd Rompza (Hg.): kunst <– gestaltung –> design. Heft 1, Saarbrücken 1995, S. 5-11
- Zu meinem künstlerischen Standort. In: Werkstatt konkreter Kunst. Remscheid 1995, S. 56
- Le language pictural à l‘épreuve. In: Mésures Art International. Heft 6. Liège/Belgien 1995, S. 6-7
- Adress on the occasion of the exhibition with works by Michael Kidner at the Gallery Suciu in Ettlingen 1995. In: Kunst Konkret. Zeitschrift für Kunst, Architektur und Gestaltung. Saarbrücken 1996, Heft 2, S. 11-12
- Interview mit Nelly Rudin. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Zeitschrift für Kunst, Architektur und Gestaltung. Heft 3, Saarbrücken 1996, S. 27-28
- Eingriffe. In: Dietfried Gerhardus, Sigurd Rompza (Hg.): kunst <– gestaltung –>design. Heft 2, Saarbrücken 1996, S. 3-8
- Kunst im öffentlichen Raum – Zur Konzeption der Hängeplastik in der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. In: Jo Enzweiler (Hg.): Kunst im öffentlichen Raum Saarland. Band 1. Saarbrücken Bezirk Mitte 1945-1996. Saarbrücken 1997, S. 100-101
- Arbeitsnotizen (Auswahl). In: Gudrun Spielvogel (Hg.): Galerie Gudrun Spielvogel 1991-96. München 1996, S. 62
- Künstlerische Gestaltung des Bereichs Innenhof im neuen Dienstgebäude für die Hauptstelle Saarbrücken der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland. In: Wettbewerbe Kunst im öffentlichen Raum im Saarland. Hg. vom Institut für aktuelle Kunst im Saarland an der Hochschule für Bildende Künste Saar. Saarbrücken 1997, S. 16-19
- Jean-François Dubreuil et Yves Popet; Zu Walter Leblancs künstlerischer Konzeption; Interview mit Gottfried Honegger, Interview mit Rolf Glasmeier. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Zeitschrift für Kunst, Architektur und Gestaltung. Heft 4, Saarbrücken 1998. S. 9-10, 11-14, 25-27, 28
- Dietfried Gerhardus, Sigurd Rompza (Hg.): Variationen. kunst <– gestaltung –> design. Heft 4, Saarbrücken 1998, 4-11
- Dietfried Gerhardus, Sigurd Rompza (Hg.): Abstrahieren. kunst <– gestaltung – >design. Heft 6, Saarbrücken 1998, 4-11
- Ein Beispiel für projektorientiertes Arbeiten in einer neuen bildlichen Gestaltungslehre: Die Copygrafie als gestalterisches Verfahren – Darstellen von Bewegung. In: Dietfried Gerhardus, Cornelieke Lagerwaard, Sigurd Rompza (Hg.): Bewegung – Versuche mit dem Kopiergerät als Beispiel für Grundlegungsprobleme bildlicher Gestaltung. Heft 7/1, Saarbrücken 1998, S. 10-19
- Sehen – Sehen als wesentliches Moment konzeptioneller Kunst. In: Material, Konzept, Konstrukt. Hg. von der Landesgalerie Oberösterreich, dem Forum Konkrete Kunst Erfurt und den Symposien zur Konkreten Kunst Gmunden. Linz 1998, S. 27-31
- Zu Ullrich Kerkers Farbläufe. In: Jo Enzweiler - Institut für aktuelle Kunst im Saarland (Hg.): Portrait Ullrich Kerker. Saarbrücken 1998, S. 8-9
- Le langage pictural à l‘épreuve, in: Kunst konkret, Hg. Jo Enzweiler und Sigurd Rompza, Saarbrücken 1999, Heft 6, S. 15-17
- Zu meinem künstlerischen Standort. In: Hochschule der Bildenden Künste Saar. Hg. von der HBKsaar. Saarbrücken 1999, S. 60
- Text zur eigenen künstlerischen Arbeit. In: Im Gehen sehen – Kunst in der Allianz Versicherungs-AG Berlin. Edition Hoffmann. Friedberg 1999, S. 189
- Briefe der Mutter als Anregung für die Lettres de ma mère – Zu Zeichnungen von Vera Molnar. In: Linde Hollinger (Hg.): Vera Molnar – Inventar 1946 -1999. Ladenburg 1999, S. 56-63
- Wie man ein Bild von Aurélie Nemours lesen kann. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst konkret. Zeitschrift für Kunst, Architektur und Gestaltung. Heft 5, Saarbrücken 1999, S. 14-16
- Orange Spirale. In: Kunst-Bau. Kunstsammlung der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland – Hauptstelle Saarbrücken. Hg. von Landeszentralbank. Saarbrücken 2000, 32-33
- Zu meinem künstlerischen Standort. In: Das entgrenzte Bild, Hg. Dietfried Gerhardus, Saarbrücken 2001, S.34-35
- Interview mit Dr. Lida von Mendgen. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Heft 7. Saarbrücken 2001 S. 15 f.
- Künstlerstatements zum Thema „Konstruieren“. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Heft 8. Saarbrücken 2002. Seite 15 f.
- Zu meinem künstlerischen Standort. In: Innovation- konstruktiv, konkret, visuell, konzeptuell, Hg. Josef Linschinger, Wien und Klagenfurt 2003, S. 92-93
- joost baljeu, leonardo mosso, klaus staudt – drei künstlerische konzepte – ein vergleich. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Heft 9. Saarbrücken 2003. S. 7-12
- Zu meiner künstlerischen Lehre an der HBKsaar. In: Sichtbar machen – Staatliche Kunstschulen im Saarland 1924-2004, Hg. Jo Enzweiler, Saarbrücken 2006, S. 332-335
- Fabriqué en Sarre – Grafikmappe 2004/2005, In: Hochschule der Bildenden Künste Saar 2003-2006, Hg. HBKsaar, Saarbrücken 2006, S. 58-59
- Zu meinem künstlerischen Standort. In: Exemplifizieren wir Kunst. Zum Fundament konkreten Gestaltens. Saarbrücken 2007, S. 32
- Für eine rezeptionsorientierte Kunst. In: Positionen konkreter Kunst heute, Hg. Jo Enzweiler und Sigurd Rompza, Saarbrücken 2009, S. 54
- Abstrahieren. In: Kunst Konkret Heft, Hg. Jo Enzweiler und Sigurd Rompza, Saarbrücken 2012, Heft 15, S. 20f.
Bibliografie: Monografien
- Matthias Bleyl, Bernd Schulz (Hg.): Sigurd Rompza: Arbeitsnotizen. Saarbrücken 1989
- Zwischen Malerei und Objekt. Ausstellungskatalog Museum der Stadt Hanau. Hanau 1988, darin: - Eugen Gomringer: Die Neue Konkrete Kunst: mehr als nur ein Konstrukt, S. 4-6 - Bernd Schulz: Bemerkungen zu den Wandobjekten von Sigurd Rompza, S. 23-26
- Sigurd Rompza – Farbige Wandobjekte. Ludwigshafen 1990, darin: Lida von Mengden, S. 3-4 - Sigurd Rompza: Systematisch Arbeiten, S. 5-11 - Sigurd Rompza: Bildanalysen, S. 12-20 - Dietfried Gerhardus: Konkrete Kunst als bildnerische Reflexion visueller Anschauung – Thesen mit Blick auf Arbeiten von Sigurd Rompza, S.22-24 - Bernd Schulz: Bemerkungen zu den Wandobjekten von Sigurd Rompza, S. 27-30
- Sigurd Rompza – Vom Relief zum Wandobjekt. Saarbrücken 1990, darin: - Ernst-Gerhard Güse, S. 7 - Walfried Pohl: Die Verwindung des Konstruktivismus – Sigurd Rompza und seine Wandobjekte, S. 9-12, - Eugen Gomringer: „Sprachkürze gibt Denkweite“ (Jean Paul) – Betrachtungen am Werk von Sigurd Rompza, 17-18 - Dietfried Gerhardus: Sigurd Rompzas interdimensionale Untersuchungen zur Farbformverschränkung, S. 23-26; Sigurd Rompza: Auf dem Prüfstand die Bildsprache – Konzeptionelle Überlegungen zu einer konstruktiv-konkreten Kunst heute – Angestellt im Hinblick auf eigene künstlerische Arbeiten, S. 29-31
- Blanka Heinecke, Linde Hollinger (Hg.): Sigurd Rompza. Mannheim und Ladenburg 1992, darin: Dietfried Gerhardus: Vereinfachung als Systematisierung der Basis, Blanka Heinecke: Zur Ausstellung, o. S.
- Blanka Heinecke, Linde Hollinger (Hg.): Sigurd Rompza: Arbeitsnotizen 1980-1998. Ladenburg und Mannheim 1998
- Jo Enzweiler (Hg.): Sigurd Rompza im Gespräch mit Monika Bugs. Interview 10. Saarbrücken 2000
- Sigurd Rompza – Etwas zum Sehen machen. Reliefs und Wandobjekte von 1974 bis 2000.. Saarbrücken 2000, darin: Dietfried Gerhardus: Vereinfachung als Systematisierung der Basis, S. 12-15; Sigurd Rompza: Zur Entwicklung meiner künstlerischen Konzeption, S. 5-10; Sigurd Rompza: Formativ exemplifizieren im Hinblick auf Etwas-zum-Sehen-machen, S. 17-19
- Sehstücke – Sigurd Rompza, Hg. Jo Enzweiler, Saarlouis 2005, darin: Dietfried Gerhardus: Drei Reden zu den Arbeiten von Sigurd Rompza: Rede im Kunstraum Klaus Hinrichs, Trier (1995). Rede im Kunstverein Dillingen, Altes Schloß (2000). Rede im Kunstverein Speyer, Kulturhof Flachsgasse (2004), S. 3-17; Sigurd Rompza: Zu den Farb-Licht-Modulierungen der Jahre 2002-2004– Künstlertheoretische Reflexionen, S. 18 - 23; Sigurd Rompza: Arbeitsnotizen, S. 7-11
- Sigurd Rompza - Künstlerische Reflexionen. Heidelberg 2011, darin: Andreas Bayer: Visuelle Forschung und künstlerische Konzeption, S. 7-8; Katja Vobiller: Vorwort, S. 9; Sigurd Rompza: Zur Entwicklung meiner künstlerischen Konzeption, S. 11-15, Auf dem Prüfstand die Bildsprache, S. 19-24, Zu den Farb-Licht-Modulierungen der Jahre 2002 bis 2004, S. 25-31, Formativ exemplifizieren im Hinblick auf Etwas-zum-Sehen-machen, S. 33-36, Bilder machen, S. 37-41, Für eine rezeptionsorientierte Kunst, S. 43-44; Sigurd Rompza im Gespräch mit Monika Bugs, S. 45-69; Arbeitsnotizen, S. 71-90
- Andreas Bayer: Sigurd Rompza – das Konzeptionelle in sinnlicher Hinsicht. In: Künstlerlexikon Saar – Künstlerblatt Sigurd Rompza. Hg. Jo Enzweiler. Saarbrücken 2012
- Andreas Bayer, Bernd Philippi, Sigurd Rompza, Editions mediArt Luxemburg (Hg.): reflexionen – Texte zum Verstehen und zur Vermittlung der Werke von Sigurd Rompza. Heft 1–9. Saarlouis 2023
Bibliografie: Sammelschriften
- Ursula Spindler: Sigurd Rompza. In: Saarheimat. Heft 7/8. Saarbrücken 1979, S. 186
- Klaus Staudt: Geschichte und Entwicklung des konstruktiven und seriellen Reliefs in Europa. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza, Ed Sommer, Klaus Staudt (Hg.): Relief konkret in Deutschland heute. Ausstellungskatalog Galerie St. Johann. Saarbrücken 1981, S. 14
- Anneliese Knorr: Votum für den Zeitgeist Rolf Glasmeiers Atelier-Galerie. In: Rolf Glasmeier (Hg.): Dokumentation 2. Kunstfeste 1975-82. Gelsenkirchen o. J., S. 4, 26-27
- Walfried Pohl: Vier Künstler zwischen Material und Kalkül; Helga und Volkmar Dietsch: Material, Volumen, Konstruktion. In: Enzweiler, Holweck, Linn, Rompza. Saarbrücken 1984, o. S.
- Alf Krister Job: Die Bedeutung der Farbe ‚Weiß‘ in der Kunst nach 1945. Offenbach 1984
- Bleyl, Matthias: Ordnung und Licht; Christina Weiß: Spielräume des Sehens. In: Matthias Bleyl, Christina Weiß (Hg.): Krieglstein, Rompza, Staudt, Tschentscher. Kunstverein Pforzheim. Pforzheim 1985, o. S.
- Ute Dreckmann: Anders. In: Funke, Kolod, Rompza, Sanovec. Bochum 1986, S. 3-4
- Dietfried Gerhardus: Spontaneität und Struktur. In: Dietfried Gerhardus (Hg.): Enzweiler, Holweck, Rompza, Staudt. Saarbrücken 1986, S. 13-19
- Dorothee Schank: Künstleraustausch über Grenzen hinweg. In: Saarheimat. Heft 5. Saarbrücken 1986, S. 129-131
- Astrid und Dietmar Guderian: Räumliche Grundformen. In: Mathematik in der Kunst der letzten dreißig Jahre. Ludwigshafen 1987, S. 109, 147
- Lothar Romain. In: Studio A – Sammlung zeitgenössischer Kunst, Museum für moderne Kunst des Landkreises Cuxhaven 1974-1986. Band 1. Hg. vom Landkreis Cuxhaven, Otterndorf Niederelbe 1987, S. 158
- Ulrike Schuck: Jo Enzweiler und Sigurd Rompza. Städtische Galerie Villingen-Schwenningen. In: Das Kunstwerk. Heft Nr. 6XL, Stuttgart 1987, S. 94
- Bernd Schulz: Form und Farbe – Farbe und Form. Saarbrücken 1988
- Michael Jähne: Form und Farbe. In: Saarheimat. Heft 3, Saarbrücken 1988, S. 68-70
- Dietrich Mahlow: Spuikom models. In: Symposium Konstruktivisme Kunst/Architectur in Vlissingen. Hg. vom Culturele Raad Vlissingen. Stichting PRO. Vlissingen/Holland 1989, o. S.
- Ulrike Schuck. In: Saarheimat. Heft 1-2, Saarbrücken 1990, S. 21-22
- Hilla Gruchot: Sigurd Rompza – Farbige Wandobjekte. Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen. In: Nike – New Art in Europe. Heft 33. München 1990, S. 48
- Pohl Wahlfried: Zur Ausstellung ‚Leonardo Mosso – Strukturen, Sigurd Rompza – Wandobjekte‘ in der Gesellschaft für Kunst und Gestaltung/ Bonn. In: Schriftenreihe Beiträge zur Aktuellen Kunst/ Heft 4, Galerie St. Johann, Saarbrücken 1990, o. S.
- Ernest W. Uthemann: Konkrete Kunst. In: Ernst-Gerhard Güse (Hg.): Saarland Museum Landesgalerie. Saarbrücken 1991, S. 43-52
- Peter Volkwein: Neuerwerbungen. In: Museum - Museum für konkrete Kunst Ingolstadt. Braunschweig 1991, S. 96-111
- Johannes Peter Hölzinger, Gerd de Bruyn: Der öffentliche Raum. Hg. vom Deutschen Werkbund Hessen. Frankfurt 1992, S. 28
- Nicole Nix: Sigurd Rompza; Eugen Gomringer: Begrenzt – unbegrenzt: Standorte – Vier Künstler im Landkreis Neunkirchen. Hg. von der Kreisstadt Neunkirchen. Neunkirchen 1993, o. S.
- Nicole Nix: Standortbestimmungen. In: Standortbestimmungen. Hg. von der Neunkircher Kulturgesellschaft. Neunkirchen 1995, S. 7-9
- Rita Horsch-Everinghoff: Konkrete Kunst im Saarland – Focussierung einer Kunstrichtung. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Kunst Konkret. Heft 2. Saarbrücken 1996, S. 5-10
- Wettbewerb der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland für die Ausgestaltung des Neubaus in Saarbrücken. Pressemitteilung anläßlich der Präsentation des Werkes von Sigurd Rompza am 5.10.1998. In: Mitteilungen des Instituts für aktuelle Kunst im Saarland. Heft 6. Saarbrücken 1998, S. 15
- Schulz, Bernd: Auf Darstellung hin erproben – Ein Interview mit Sigurd Rompza. In: Zeitschrift der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Saarbrücken 1999, S. 12
- Sabine Graf: Kennst du das Land... - 50 Jahre Einsamkeit? In: Kunst-Bau. Kunstsammlung der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland - Hauptstelle Saarbrücken. Hg. von Landeszentralbank. Saarbrücken 2000, S. 10-17
- Christoph Wagner: Die Wissenschaft als Thema der Kunst? Ortsbeziehungen der Kunst im öffentlichen Raum an der Universität des Saarlandes. In: Jo Enzweiler (Hg.): Kunst im öffentlichen Raum Saarland. Band 2. Universität des Saarlandes 1945 bis 1999. Saarbrücken 1999, S. 20-27
- Ursula Briel: Kunst am Bau auf dem Campus der Universität des Saarlandes: ein visuell-didaktischer Rundgang. In: Jo Enzweiler (Hg.): Kunst im öffentlichen Raum Saarland. Band 2. Universität des Saarlandes 1945 bis 1999. Saarbrücken 1999, 61-65; 125
- Josef Linschinger (Hg.): Innovation konstruktiv konkret visuell konzeptuell. 10. Gmundener Symposion. Gmunden 2000
- Ernest W. Uthemann: Abstraktion I und Silke Immenga: Sigurd Rompza. In: Kunstszene Saar – Visionen 2000. Künstlerische Positionen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Herausgegeben von der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz. Saarbrücken 2000, S. S. 21 und 80 f.
- Michael Jähne: Die Kunstsammlung der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Hauptstelle Saarbrücken. in: Kunst konkret, Hg. Jo Enzweiler und Sigurd Rompza, Saarbrücken 2001, Heft 7, S. 6-7
- Konkret und konstruktiv. grafik malerei objekte skulptur. Wiligrad 2001
- Martina Plümacher: Bildgrenzen aufbrechen; Eugen Gomringer: Begrenzt – unbegrenzt. In: Dietfried Gerhardus (Hg.): Das entgrenzte Bild. Saarbrücken 2001. S. 67-71 und 77
- Vincent Baby: Le système Molnar, une approche. In: re Connaître /Vera Molnar, Hg. Musée de Grenoble, Grenoble 2001, S.18-62
- Kunstwerke im öffentlichen Raum – eine Ausstellung im Foyer der Modernen Galerie des Saarland Museums 26. Bis 30. Oktober 2002. In: Mitteilungen des Instituts für aktuelle Kunst im Saarland. Heft 10. Saarbrücken 2003, S. 62
- Künstler zeigen Künstler. Saarbrücken 2003
- Multiple Grafik und Objekte. Saarbrücken 2003
- Claudia Maas, Michael Jähne (Hg.): neue gruppe saar. Saarbrücken 2003
- Espace de l’Art Concret – Donation Albers-Honegger, pour un art concret – Konkrete Kunst – Schenkung Albers-Honegger, Katalog isthme éditions – Centre national des arts plastiques, 2004, S. 158, 263
- Christoph Wagner: Kunst auf dem Campus. In: Campus, Hg. Universität des Saarlandes, Saarbrücken 2005, S. 8-17
- Sandra Kraemer: Sigurd Rompza. In: Edition Laboratorium 13, 2005. Mappe mit drei Grafiken. Hg. Institut für aktuelle Kunst, Saarlouis
- Sandra Kraemer: 1989-2004 / HBKsaar –
- Struktur und Ziele. In: Jo Enzweiler (Hg.): sichtbar machen - Staatliche Kunstschulen im Saarland 1924-2004. Saarbrücken 2006, S. 256-257
- Johannes Fischinger: Studierende aus dem Atelier Prof. Sigurd Rompza im Klinikum Homburg/Saar. In: Hochschule der Bildenden Künste Saar 2003-2006, Hg. HBKsaar, Saarbrücken 2006, S. 72-73
- Sandra Kraemer: Sigurd Rompza – Edition Laboratorium 2006, in: Mitteilungen 2005/6, Hg. Jo Enzweiler. Saarbrücken 2007, S. 38-39
- Michael Jahne: Sigurd Rompza. In: 8 x Konkret. Concrete art in Europe today. Selected by Galerie St. Johann, Saarbrücken. Saarbrücken 2007, S. 18-19
- Martina Plümacher: Erproben und Erraten; Beate Reifenscheid: Die erweiterte Suche nach der reinen Form. In: Dietfried Gerhardus (Hg.): Exemplifizieren wir Kunst. Zum Fundament konkreten Gestaltens. Saarbrücken 2007, S. 38-41, 42-45
- Paul Bertemes: Fragen an den Künstler. Michael Jähne: Sigurd Rompza. In: Paul Bertemes, Jean Colling (Hg.): Visites d‘Atelier. Atelierbesuche. Luxemburg 2007, S. 108, 109-115
- Dein Land macht Kunst. Hg. von Ralph Melcher, bearbeitet von Julia Frohnhoff. Saarbrücken 2008, S. 260-263
- Krisztina Passuth: Woher – wohin? Exemplifizieren wird Kunst, in: Kunst Konkret, Hg. Jo Enzweiler und Sigurd Rompza Saarbrücken 2008, Heft 13 S. 11-14
- Gmundner Syposien für Konkrete Kunst, Hg. Landesgalerie Linz am Oberösterreichischen Landesmuseum, Wien/Klagenfurt 2008
- Satoru Sato Art Museum, Bestandskatalog, Tome Japan 2008, S. 70
- Rompza Sigurd. In: Bibliotheca Durantiana – Reliures d’artistes modernes & contemporains (3), Hg. Bibliotheca Wittockiana, Brüssel 2009, S. 68f
- Isabella Fehle: Logik und Zufall. Lorenz Dittmann: Positionen Konkreter Kunst heute. In: Jo Enzweiler, Sigurd Rompza (Hg.): Positionen konkreter Kunst heute Saarbrücken 2009, S. 8 f, 23 f
- Reconnaître. Hg. Kunsthalle Paks. Redaktion Prosek Zolán. Paks 2009,S. 120-121
- Sabine Graf: Galeriearbeit mit anderen Mitteln: Die Zeitschrift Kunst Konkret „...nicht nur ein Blatt zusätzlich...“. Laden wir Sie und ihre Freunde recht herzlich ein, Ausstellungen 1969-2009. Verlag St. Johann. In: Galerie St. Johann 1969-2009, Hg. Galerie St. Johann, Saarbrücken 2009, S. 102, 105, 115, 124-126, 128-131, 139, 141, 142
- Musées des Sens, Couleur et Géométrie Actualité de l’Art construit europée. Sens/Frankreich 2010, S. 134, 135, 156
- bilder machen – zum problem des herstellens und darstellens in der konkreten kunst. In: Kunst Konkret, Hg. Jo Enzweiler und Sigurd Rompza. Heft 14,, Saabrücken 2009, S. 15
- L’oblique – un regard sur la géométrie contemporaine, Musées du château des ducs de Wurtemberg, Monbéliard 2009, S. 83
- Dittmann Lorenz, Der Sparda-Bank-Kunst-Raum in Saarbrücken. Hg. Institut für aktuelle Kunst, Saarlouis und Sparda-Bank Südwest eG, Saarbrücken, Saarbrücken 2010, S. 24f
- Point, line in movement. Hg. Dora Maurer, Budapest 2010, S. 48, 49, 73
- Klaas Huizing: Die Entschleunigung durch Kunst – Ein Besuch beim Sammlerehepaar Kaldewey. In: Opus Kulturmagazin, No 20, Saarbrücken 2010
- Bellec Mael, Formes et lumière - La sculpture dans l’art construit: execises de style. In: Escaut, rives, dérives. Festival international de sculpture contemporaine, Somogy éditions, Paris et Association Escaut et Acier, 2011, S. 91
- Michael Jähne. Sigurd Rompza. In:Kunsthöfe im Ravelin I, Saarlouis. Saarbrücken 2011, Nr. 6
- Kunstlexikon Saar Kunstort. Der Sparda-Bank-Kunst-Raum in Saarbrücken. Text: Lorenz Dittmann, Saarbrücken 2011, S. 24
- Mael Bell: Formes et lumière - La sculpture dans l’art construit: execises de style, in: Escaut, rives, dérives. Festival international de sculpture contemporaine, Somogy éditions, Paris et Association Escaut et Acier, 2011, S. 91
- Dittmann Lorenz: Verspannung und Wandgestaltung. In: Kunst auf dem Campus. Hg. Jörg Pütz und Henry Keazor. Saarbrücken 2012, S. 128-131
- Saar Art 2013. Zehnte Landeskunstausstellung. Band 1. Hg. Andreas Bayer. Saarbrücken 2013, o. S.
- Die Sammlung Klütsch. Herausgegeben vom Museum Haus Ludwig für Kunstausstellungen Saarlouis. Saarlouis 2015, S. 32-35
- Museum St. Wendel, Stiftung Dr. Walter Bruch (Hg.): Saarart11. Redaktion: Eva Dewes, Cornelieke Lagerwaard, Friederike Steitz. St. Wendel 2017, S. 208, 209
- Günter Scharwath: Das große Künstlerlexikon der Saar-Region. Biografisches Verzeichnis von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern der Saar-Region aus allen Fachrichtungen und Zeiten. Saarbrücken 2017, S. 869
Homepage / Quelle
- www.rompza.de
- Institut für aktuelle Kunst im Saarland, Archiv, Bestand: Rompza, Sigurd (Dossier 3848)
Redaktion: Claudia Maas, Petra Wilhelmy